
![]()
Navigation fehlt?
Hier klicken!
Einleitung
Auf dieser Seite werde ich in unregelmäßigen Abständen Kommentare, Randbemerkungen oder Schmähschriften zum Gebrauch der deutschen Sprache veröffentlichen. Sei es aus aktuellem Anlass, oder weil mir der falsche, häufige bzw. unangebrachte Gebrauch eines Wortes oder einer Redewendung aufgefallen ist, oder weil es mir einfach in den Kopf kam. Ich beziehe mich dabei auf Presse, Internet, Funk und Fernsehen, auf Werbung, Politsprech und Dummdeutsch.
Was Sprache anbelangt, so bin ich ein Wertkonservativer, der bemüht ist, Neuschöpfungen, Denglisch und ähnliche sprachliche Torheiten weiträumig zu umschiffen – was natürlich nicht in allen Fällen gleichermaßen glückt. Gegen Fachchinesisch, das quasi bis zu Unkenntlichkeit verdenglischt ist, kann man sich ja praktisch gar nicht mehr wehren. Ein weiteres Problem ist die Journalistensprache, die sich auf manchen Gebieten in erschreckender Weise verselbständigt hat. Gegen solcherlei Auswüchse werde ich in bester don-quixotescher Manier zu Felde ziehen. Die Anmerkungen dazu sind subjektiv, in jedem Falle rechthaberisch und oberlehrerhaft und teilweise polemisch. Dass diese keinesfalls allzu ernst genommen werden sollten (zumindest nicht alle), versteht sich hoffentlich von alleine ...
Der Aufbau entspricht einem Blog: Die älteren Artikel befinden sich am Ende der Seite, die aktuellen oben. Zum gezielten Anspringen von zurückliegenden Beiträgen benutzen Sie bitte das Inhaltsverzeichnis.
Sie können natürlich auch chronologisch vorgehen: Springen Sie zu
diesem Zweck zunächst ans Ende der Seite. Sie können
dann mit den kleinen Pfeilen auf der rechten Seite navigieren. „![]() vor“ bringt Sie zum nächsten, neueren Artikel, „
vor“ bringt Sie zum nächsten, neueren Artikel, „![]() zurück“ springt zum vorhergehenden, älteren Artikel.
zurück“ springt zum vorhergehenden, älteren Artikel.
Inhalt
Spot-Premiere
... oder: Wie die Werbeindustrie wieder einmal versucht, den Fernsehzuschauer zu verschaukeln.
zurück
Es soll hier heute um den neuesten und spitzesten Pfeil im Köcher der TV-Werbegestalter gehen: die Spot-Premiere. Schauen wir uns doch zuerst einmal die Definition im Filmlexikon der Uni Kiel an:
| Sonderwerbeform, bei der ein Spot von mindestens 20 Sekunden Länge unmittelbar vor dem Start des Hauptabendprogramms gleichzeitig auf den wichtigsten Privatsendern läuft. Meist handelt es sich um die Uraufführung des Spots (daher rührt die Bezeichnung) und wird ergänzt um 120-150 Sekunden lange Making-of-Sequenzen |
Es handelt sich also um ein cinematisches Ereignis von allergrößter Relevanz und kompromissloser Qualität, anlässlich dessen auch noch im Anschluss der Meister selbst und seine getreuen Mimen bei ihrem künstlerischen Schaffensprozess gezeigt werden. Steven Spielberg goes Eduscho, sozusagen.
Mal ehrlich: Kein Mensch, wirklich keiner, will sich Werbung anschauen. Jeder hasst sie – von den Produzenten und deren Auftraggebern vielleicht einmal abgesehen.
Doch irgendein schlauer Fuchs kam eines Tages auf die Idee, dem offensichtlich völlig verblödeten Fernsehzuschauer seine bescheuerte Werbung als Premiere zu verkaufen. Schaut her: Dieser Spot wird genau jetzt zum allerersten Mal gezeigt und ihr könnt später noch euren Enkeln davon erzählen, wie ihr Zeugen dieses formidablen Ereignisses wart. Und seine Chefs klopften ihm anerkennend auf die Schulter und fanden die Idee ganz wunderbar und überschütteten ihn mit Goldstücken, und die Zuschauer jubelten ob der phantastischen Darbietung und wollten gar nicht mehr umschalten.
Das fand allerdings in einem unbekannten Parallel-Universum statt, in dem wir uns glücklicherweise nicht befinden. Und so kann ich dazu nur sagen: „Wen juckt's?“ bzw. im Jargon der etwas Jüngeren: „Wayne interessiert's?“
Auch wenn ich einen Kuhfladen lecker mit Käse überbacke und mit einem Petersilienzweig, einem Tomatenschnitz und einem Sardellenröllchen hübsch auf einem Teller anrichte, bleibt es trotzdem ein Haufen Scheiße. Das muss man mal in aller Härte und Klarheit so aussprechen.
Es spielt eben keine Rolle, ob es sich um eine Premiere oder einen ganz normalen Werbespot handelt: Werbung bleibt Werbung. Plump, öde, lästig, nervig, aufdringlich. Da nützt auch eine noch so großartige Ankündigung »SPOT-PREMIERE« nicht.
Im Gegenteil: Ich als Betroffener dieses Reklame-Attentats muss plötzlich einsetzende Benommenheit abschütteln, im selben Sekundenbruchteil fluchend die Fernbedienung an mich reißen und ...
... na, Sie wissen schon was ...
Sie tun's doch hoffentlich auch, oder?
Jetzt streamen!
... oder über die grüne Taste auf der Fernbedienung aufrufen.
zurück

Werden Sie auch täglich von Ihrem Fernseher in diesem Kasernenhofton angegangen? Wie geht es Ihnen dabei? Fühlen Sie sich eingeschüchtert, bevormundet, überrannt? Geht Ihnen das genauso gewaltig auf den Nerv wie mir?
Ich meine, was denken sich Fernsehanstalten (allen voran ZDFneo), deren Betreiber und Verantwortliche eigentlich, wie viel Zeit und Lust unsereins hat, ständig an irgendeinem Endgerät herumzusitzen und irgendwelche Sendungen zu streamen?
Vielleicht habe ich gerade gar keine Zeit oder Lust zum Fernsehschauen, weil ich gerade meine Wohnung putzen, den Wocheneinkauf erledigen, mit der Nachbarin Kaffee trinken oder den Keller aufräumen möchte? Das ist doch alles viel wichtiger als Fernsehen. Aber das können sich Medienschaffende wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen.
Und wissen die was über meine Fernbedienung, das ich nicht weiß? Wenn ich auf die grüne Taste meiner TV-Fernbedienung drücke, geschieht nämlich genau nichts! Alle anderen habe ich auch schon durchprobiert – da schaltet sich maximal das zugehörige Gerät aus; also auch wieder nix mit Schtriemen.
Und dann ständig dieser Befehlston. „Jetzt streamen!“ „Jetzt über die grüne Taste auf Ihrer Fernbedienung ...“, los, mach schon – man könnte sich glatt belästigt fühlen. Was stimmt mit diesen Leuten nicht?!
Einen freundlichen Hinweis fände ich hier angebrachter: „Diese Sendung können Sie ab sofort in unserer Mediathek streamen“. „Wenn Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist, können Sie eventuell mit der grünen Taste Ihrer Fernbedienung ...“. Wäre damit die Aufmerksamkeitsspanne des Zuschauers bereits überreizt? Ich denke nicht.
Ich jedenfalls möchte nicht ständig in barschem Ton von meinem Fernseher angeblafft werden. Ein Minimum an Höflichkeit kann man doch wohl erwarten, oder?
Fernsehanstalten: Aufgepasst! Jetzt merken! Netter zum Kunden sein! Wegtreten!
Farbenlehre
Über die Deklination von attributiven Farb-Adjektiven – am Beispiel von orange und lila.
zurück
Samstägliche Abendunterhaltung im Zweiten Deutschen Fernsehen. Eine Frau Heinrich moderiert »Das Große Deutschlandquiz«. Dabei sitzen sich je vier prominente Rate-Kandidaten auf zwei Seiten gegenüber. Zur einfacheren Unterscheidung ist die eine Seite durch die Farbe Orange gekennzeichnet, die andere bekam die Farbe Lila.
Frau Heinrich bezeichnete nun während der gesamten zweieinhalbstündigen Sendung mit ungerührter Hartnäckigkeit die eine als „orangene Seite“ und die andere als „lilane Seite“. Und jedes Mal durchzuckte meinen Körper ein heftiger Schmerz. Warum?
Ich hole einmal etwas weiter aus: Farben begegnen uns im Alltag zumeist in Form von Adjektiven (Eigenschaftswörtern). Der Mann ist blau, die Wiese ist grün, das Auto ist rot. Wollen wir aber die Farbe vor den Gegenstand setzen, dann ändert sich im Deutschen die gesamte Grammatik. Denn jetzt sind blau, grün und rot nicht mehr nur einfache Adjektive, sondern attributive Adjektive – und die müssen wir deklinieren. Wir bekommen dann also einen blauen Mann, eine grüne Wiese und ein rotes Auto.
Wie sieht es aber mit exotischeren Farben aus? Was macht man mit orange, rosa, lila, beige, mauve? Normalerweise bleiben Farb-Adjektive, die auf einem Vokal enden undekliniert. Das orange Haus, die rosa Brille, die lila Blume, der beige Mantel. Wobei orange, beige und mauve (also französische Farbbezeichnungen, die auf [Konsonant + e] enden) Sonderfälle darstellen, da das e am Ende des Wortes in der Grundform stumm ist [oˈrɑ̃ːʒ], [beːʒ], [moːv] aber in der attributiven Form als Schwa [ə] gesprochen, also »schon irgendwie« dekliniert wird.
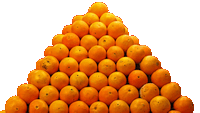
Dieses könnte man gleichermaßen als orange Pyramide (von oranger Farbe) oder als orangene Pyramide (aus Orangen bestehend) bezeichnen – tut man aber nicht: Es ist eine Orangenpyramide.
Weil orange, beige etc. also quasi nicht auf einem Vokal enden, werden sie wie alle anderen Farben dekliniert: grün, ein grüner, eine grüne, ein grünes; beige, beiger, beige, beiges; orange, oranger, orange, oranges. Alle anderen Farben, die auf Vokalen enden (bleu, lila, magenta, écru) werden nicht dekliniert. Wem dann die bleu Hose nicht gefällt, der kann immer noch zur bleufarbenen greifen.
Und wie steht es um Gold und Silber? Wie heißen die korrespondierenden Farben? Golden und silbern. Der goldene Herbst, der silberne See. Warum sagt man dann aber nicht orangen wenn man orange-farbig meint? Weil silbern eigentlich »aus Silber« bedeutet, genau wie golden »aus Gold«, hölzern »aus Holz«, tönern »aus Ton« usw. Wenn etwas also aus Orangen besteht, dann (und nur dann) könnte man es als orangen bezeichnen.
Händlorkäachtschtn, Teil II
Weitergehende Bemerkungen und Informationen zu »Bares für Rares«*
*Sie sollten zuerst Teil1 gelesen haben.
Zuallererst sollte man sich stets bewusst sein, dass diese Sendung von Anfang bis Ende geskriptet ist. Nichts wird dem Zufall überlassen. Sowohl die Kandidaten als auch die angebotenen Objekte durchlaufen Eignungstests. Die Experten haben ein Team, das ihnen zuarbeitet. Die langen Menschenschlangen vor den Expertentischen sind lediglich Staffage. Auch bei den Expertengesprächen, die scheinbar zeitgleich an Nebentischen laufen, sind nur Komparsen und Requisiten zugegen. Einzig die Preisfindung und die Verkaufsverhandlungen sind ergebnisoffen.
Herr Lichter ist eine rheinische Frohnatur mit kölschem Akzent. Er ist Hansdampf in allen Gassen und weiß, wie man auf Menschen zugeht und ihr Vertrauen gewinnt. Erkennungsmerkmale: großer Schnäutzer, kleine Brille mit kreisrunden Gläsern, ständig aktives Mundwerk. Seine Kaspereien zu Anfang und Ende der Sendung laden stets zu extremem Fremdschämen ein, scheinen aber bei den eingefleischten Fans der Sendung recht beliebt zu sein. Ansonsten neigt Herr Lichter stark zu Schmeicheleien und zu Indiskretionen – wenn er beispielsweise der Frau Doktor oder der Wendela einigermaßen aufdringliche Komplimente macht, oder den Verkäufer befragt, wozu die Kohle denn verwendet würde. Er verwendet mindestens einmal pro Sendung das Wort »zumindestens«. Außerdem hat ihm anscheinend noch niemand den Unterschied zwischen den Begriffen Akzent und Dialekt erklärt, die er zuverlässig durcheinander bekommt. Ähnlich ist es mit Lampe, Leuchte und verwandten Begriffen wie Leuchtmittel und Beleuchtungskörper (von der Birne ganz zu schweigen).
Die Experten haben in der Sendung einen fast gottgleichen Status. Sie scheinen wirklich alles über wirklich alles zu wissen. Das sähe ganz anders aus, wenn diese exaltierten Wesen die zu bewertenden Objekte tatsächlich zum ersten Mal in Händen hielten. Ohne die Möglichkeit, die Ware vorab zu besichtigen und ohne die Recherchen des im Hintergrund wirkenden Teams stünden sie wohl oftmals mit sprichwörtlich heruntergelassenen Hosen da.
Die Verkäufer kommen aus fast allen Schichten der Bevölkerung, haben sich aber für diesen wichtigen Tag meist in die beste zur Verfügung stehende Garderobe geworfen und sich mit feinstem Schnöseldeutsch parfümiert. Da wird nicht ge- oder verkauft, sondern erworben oder veräußert. Die Mutter ist nicht ge- sondern verstorben. Den mitgebrachten Plunder bezeichnen sie gerne als Exponat oder als Gegenstand. Das Wort entsprechend wird gerne und entsprechend beiläufig eingestreut. Im krassen Gegensatz dazu wird häufig von der Omma erzählt, die ich persönlich, zumindest im Fernsehen, eher als Großmutter bezeichnen würde. Der Typus des Verkäufers kann vom schneidigen Draufgänger bis zum verhuschten Häschen alles umfassen. Auf den Verkaufserfolg hat das nur selten Auswirkungen.
Die Händler sind
allesamt Typen, die man mögen kann oder nicht. Das geht vom polterigen
Vollproll aus der Eifel über die mädchenhaft kichernde Schmuck- und
Pferdeliebhaberin und den gefärbt-gepiercten Modeafficionado bis zum
tiefbayerischen hochbetagten ehemaligen Kunstturner – um nur einige wenige zu
nennen. Allen gemein ist die Krämerseele – der tief in die Wolle gefärbte
Drang und Wille, möglichst billig einzukaufen und möglichst teuer zu verkaufen. Die sogenannten
Startgebote sind oftmals wirklich obszön niedrig, aber auch die Endgebote
liegen oftmals weit unter der Expertise – gerne mit dem Hinweis darauf, dass
man selber ja auch noch ein bisschen was verdienen müsse. Was nicht heißt,
dass nicht auch das eine oder andere Teil über Expertise verkauft wird.
Die Ware kann im Prinzip alles sein, das entweder alt, kurios,
selten oder am
besten alles zusammen ist. Alte Ölgemälde, Spiegel, Geschmeide, Plastiken, Drucke,
Bücher, Fanartikel, Nippes … nur echt und alt müssen die Sachen sein.
Fälschungen und Dinge, die noch keine dreißig Jahre alt sind, kommen in der
Regel nicht in den Handel. Der Wert reicht meistens von ca. zehn Euro bis
maximal vier- bis fünftausend Euro. Für noch wertvollere Objekte gibt es
Sondersendungen.
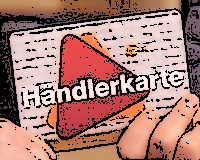 Die Händlerkarte (vulgo dat Händlorkäachtschn) gehört zu den wichtigsten
Requisiten von Bares für Rares. Wozu das Teil, das stets verschwörerisch und
in Großaufnahme übergeben wird, und über das sich die Verkäufer wie verrückt
freuen, tatsächlich gebraucht wird, ist mir völlig unklar. Es würde doch
völlig reichen (da das Ganze ja sowieso geskriptet ist) da drüben (wo auch
immer das ist) anzurufen und zu sagen: „Da kommt jetzt Frau XY mit nem Ring.
Wisster Bescheid, nä?“. Aber nein: Da wird mit weiter Geste die
Lichter-Po-warme Händlerkarte aus der Tasche gezogen, mehrere
Sekunden lang wie in einem schlecht gemachten Werbe-Spot in die Kamera
gehalten, um schließlich fast widerwillig dem Verkäufer überlassen zu werden.
Die Händlerkarte (vulgo dat Händlorkäachtschn) gehört zu den wichtigsten
Requisiten von Bares für Rares. Wozu das Teil, das stets verschwörerisch und
in Großaufnahme übergeben wird, und über das sich die Verkäufer wie verrückt
freuen, tatsächlich gebraucht wird, ist mir völlig unklar. Es würde doch
völlig reichen (da das Ganze ja sowieso geskriptet ist) da drüben (wo auch
immer das ist) anzurufen und zu sagen: „Da kommt jetzt Frau XY mit nem Ring.
Wisster Bescheid, nä?“. Aber nein: Da wird mit weiter Geste die
Lichter-Po-warme Händlerkarte aus der Tasche gezogen, mehrere
Sekunden lang wie in einem schlecht gemachten Werbe-Spot in die Kamera
gehalten, um schließlich fast widerwillig dem Verkäufer überlassen zu werden.
Rätsel: Ich habe mich schon öfter gefragt, ob Herr Lichter eine speziell für diesen Anlass gefertigte Hose trägt, denn ich kenne kein Beinkleid von der Stange, in dessen Gesäßtasche so eine riesige Karte passen würde. Möglicherweise ist das Ganze ja auch eine optische Täuschung und »dat Käachtschn« wird ihm von einer im Verborgenen agierenden Hilfskraft zugesteckt?
Die Preise muss man zuerst einmal verstehen: Der Experte gibt eine Summe an, zu der so ein Teil auf dem freien Markt normalerweise verkauft wird. Im Händlerraum ist aber kein freier Markt, denn dort sitzen Händler, die Waren am liebsten für hundert Euro einkaufen und für vierhundert Euro verkaufen, und die von diesen mageren drei Prozent Gewinn ihr ärmliches Leben bestreiten müssen.
Ich frage mich immer, warum die Experten dermaßen unrealistische Expertisen erteilen, anstatt eine für den Verkäufer brauchbare Summe zu nennen, die tatsächlich erreichbar wäre. Aber das gehört wohl zum Selbstverständnis dieser Sendung. Andererseits wundere ich mich dann aber auch über Verkäufer, die bei Angeboten teilweise unter der Hälfte des Expertisen-Preises kleinlaut noch „ein bisschen mehr“ haben möchten, anstatt selbstbewusst darauf hinzuweisen, dass da noch „sehr viel mehr“ kommen müsse. Völlig normal hingegen: Wenn tatsächlich mal ein Angebot durch die Decke ging, hat noch nie ein Verkäufer vorzeitig gesagt: „Jetzt is’ aber genug“.
Was ich nicht verstehe: Der Verkäufer wird um Nennung eines Wunschpreises gebeten; liegt die Expertenschätzung darunter, wird der Kandidat gefragt, ob er denn auch zu diesem Preis verkaufen würde, denn ansonsten könne man die Händlerkarte nicht herausrücken. Andererseits wird aber im Händlerraum immer wieder dezidiert darauf hingewiesen, dass »hier niemand zum Verkaufen gezwungen wird«. Warum also gibt es Anbieter, die nicht zum Expertenpreis verkaufen wollen und deshalb die Händlerkarte nicht bekommen? Warum sagt man nicht einfach »ja« und macht später bei den Händlern einen Rückzieher, wenn die Gebote zu niedrig sind?
Der Onkel aus dem Off (ein gewisser Volker Wolf) ist in BfR allgegenwärtig und kommentiert – mit dem altväterlichen Duktus eines pfeifchenschmauchenden Märchenonkels – das Präsentierte aus dem Hintergrund (fachsprachlich off-screen oder aus dem Off). Leider werden ihm allzu oft unterirdisch schlechte Wortspiele in sein Manuskript geschrieben. Das grenzt manchmal wirklich an schwere Körperverletzung. Zusammen mit dem allgegenwärtigen musikalischen Gedudel im Hintergrund bildet er das Gerüst, das Bares für Rares zusammenhält.
Die Guten Hände: Mindestens einmal pro Sendung äußert einer der Kandidaten, dass es ihm gar nicht so sehr ums Geld gehe, sondern er vielmehr froh wäre, den angebotenen Gegenstand in „gute Hände“ abgeben zu können. Da schlägt mein innerer Bullshit-Detektor immer bis zum Maximum aus: Wenn ich schon willens bin, meinen Trödel an Händler zu verramschen, kann ich eigentlich sicher sein, dass dessen Hände lediglich an Banknoten und nicht an behutsamem Umgang und tiefster Wertschätzung interessiert sind. Will ich etwas in „gute Hände abgeben“, dann muss ich mich vorher eingehend und sorgfältig informieren, welcher Empfänger dazu geeignet sein könnte – ein Händler ist es, entgegen eigener aufrichtigster Beteuerungen, sicher nicht.
Der Spaß damit: Zum Abschied geben die Verkäufer meist noch eine Abschiedsformel von sich: „Und viel Spaß damit“. Und zwar egal, um was es sich bei der Ware handelt. Vasen, Bilder, Bronzeskulpturen, alte Küchengeräte, antike Maschinen: „viel Spaß damit“. Wie, bitteschön, soll jemand mit einem Flaschenverkorker „Spaß“ haben? Ginge es um einen antiken Holzdildo oder ein Louis-XVI-Furzkissen, wäre die Sache klar, aber „Spaß“ mit einem Ölgemälde, einem Rechenschieber oder einem Zigaretten-Etui? Da muss ich fluchtartig das Kopfkino verlassen ...
Rituale: Die völlig blödsinnige Einleitung durch Herrn Lichter, die Vorstellung der Verkäufer, die gefakte Expertise, die Übergabe der Händlerkarte, die Verkäufer-Statements, der Onkel aus dem Off, die ständig im Hintergrund dudelnde Musik, der völlig blödsinnige Epilog durch Herrn Lichter – alles muss exakt festgelegten Ritualen folgen, genau wie beim Sonntagsgottesdienst. Alles andere wäre der Fangemeinde vermutlich nicht zuzumuten. Und genau aus diesem Grund gibt es diese Fangemeinde überhaupt: Man weiß genau, was passieren wird, wie es passieren wird und wann. Der deutsche – und insbesondere wohl der ältere deutsche – ZDF-Konsument braucht das anscheinend. Er will keine Veränderung, er will das Erwartbare, das Ritual. Deshalb hat Bares für Rares so konstant hohe Einschaltquoten.
Ich gebe gerne zu, dass auch ich ein einigermaßen regelmäßiger Zuschauer bei Bares für Rares bin. Allerdings hänge ich dabei nicht mit verklärtem Blick und offenem Mund vorm Fernseher, sondern beobachte die Vorgänge auf dem Bildschirm und mich selbst währenddessen meistens recht genau. Ich gebe auch gern zu, dass die Sendung professionell und routiniert gemacht ist (von den Fremdschäm-Momenten am Anfang und am Ende einmal abgesehen, bei denen ich immer den Ton ausschalte) und auch durchaus lustige und informative Momente hat. Ich denke jedoch auch, dass ich den Unterhaltungswert dieser Sendung an anderen Stellen finde als viele andere Fans der Reihe. Aber das ist es ja auch, was das Konzept von BfR gerade auszeichnet: Es ist für jeden Geschmack und jede Gemütslage etwas dabei.
Weitere interessante Details zur Sendung finden Sie übrigens in der Wikipedia.
Händlorkäachtschn Teil I
Eine Einführung in die wunderbare Welt von »Bares für Rares«
Anknüpfend an den vorhergehenden Eintrag möchte ich hier einmal für alle, die es nicht kennen und solche, die es trotzdem interessiert, das Paralleluniversum der im ZDF bzw. ZDF Neo ausgestrahlten Unterhaltungssendung »Bares für Rares« vorstellen. Einfach ausgedrückt geht es darum, dass Leute wie Du und ich ihren nicht mehr benötigten Plunder zu möglichst hohen Preisen an Antiquitätenhändler verscherbeln wollen. Dazu müssen sie einen streng ritualisierten Prozess durchlaufen.
Schauen wir uns so eine Sendung und ihr Personal einmal an. Ich verzichte im Folgenden bewusst auf irgendeine Form von Gendern, da das den Text unnötig aufblähen würde, beziehe mich aber vorurteilslos auf alle bekannten und noch zu erforschenden Geschlechtervarianten.
1. Der Beginn: Ein gewisser Horst Lichter (im Folgenden Herr Lichter genannt, die älteren unter uns kennen ihn noch als Koch) moderiert die Sendung an, indem er irgendeinen kindischen Quatsch zum Besten gibt, vorgibt mit irgendetwas Wichtigem beschäftigt zu sein und/oder irgendeinen dümmlichen Dialog mit einem seiner Mitstreiter führt, um anschließend mit „häachtsch willkommen zu Bares für Rares“ den Zuschauer zu begrüßen. Schnitt. Intro mit rockiger Titelmelodie.
2. Die Einleitung: Der Onkel aus dem Off stellt den ersten Kandidaten mit vollem Namen vor, Alter und Herkunftsort werden eingeblendet. Der prospektive Verkäufer sagt ein, zwei Sätze, verrät aber noch nicht, worum es geht (die Spannung …).
3. Die Vorstellrunde: Eines der häufigsten Szenarien: Der Experte steht an einem Pult im Expertenraum und betrachtet das angebotene Objekt. Herr Lichter tritt hinzu, meist gut gelaunt, und gibt schon einmal eine eigene Meinung zu dem Stück ab, die aber meistens nicht allzu ernst zu nehmen ist. Der Experte erklärt schon mal ein wenig. Der Anbieter wird hinzugebeten. Man begrüßt sich und klärt, ob man sich mit Vornamen anspricht (was Herrn Lichter sehr sympathisch ist) oder nicht (was Herrn Lichter immer etwas verlegen macht). Mit den Lichter’schen Worten „da hast du uns ja wat Dollet mitjebracht“ beginnt nun die Befragung des Verkäufers, woher das gute Stück stammt und wie es in seinen Besitz gekommen ist. Möglicherweise folgen auch noch einige Worte zur eigenen Person, zu Hobbys und besonderen Tätigkeiten (besonders beliebt: Moppedfahren – da hat man in Herrn Lichter sofort einen Freund fürs Leben).
4. Die Expertise: Der Experte erklärt nun in mehr oder weniger nüchternen Worten, worum es sich handelt, zeigt – umgeben von einer Aura der absoluten Unfehlbarkeit – Besonderheiten und Fehler auf, kennt jedes noch so kleine Detail zu Ursprung, Herstellung und Vertrieb, brilliert mit Fachwissen und Kompetenz. Herr Lichter hat auch stets die eine oder andere Frage, die der Experte geduldig beantwortet.
5. Die Preisfindung: Der Verkäufer wird nun nach seiner Preisvorstellung gefragt, worauf dieser sich oft etwas ziert, bevor er dann, meist auf hartnäckiges Nachfragen, mit einer Summe herausrückt. Nun wird der Experte gefragt (oft auch unterstützt durch den Onkel aus dem Off), was das Objekt der Begierde denn nun wirklich wert sei. Auch der Experte druckst erst noch ein wenig herum (die Spannung …), bevor er dann schließlich einen Betrag nennt. Der – je nach Ergebnis – ernüchterte, ungerührte oder erstaunte Verkäufer muss jetzt nur noch offiziell äußern, ob er denn zu dem genannten Preis verkaufen würde. Wird das positiv beschieden, dann zieht Herr Lichter aus der Gesäßtasche seiner Hose die Händlerkarte, die zum Eintritt in den Händlerraum berechtigt (dat Händlorkäachtschn). Mit den Worten „da jedederübbor“ wird die Karte dem Verkäufer übergeben, wobei dieses Ritual, bei dem der eine nicht loslassen will und der andere vergeblich zieht, stets in Großaufnahme erfolgt.
6. Freud und Leid: Der Verkäufer gibt ein weiteres kurzes Statement des Inhalts ab, dass er sich riesig freut, die Händlerkarte bekommen zu haben, bzw. dass er nicht damit gerechnet hat, diese zu bekommen, bzw., dass er schon damit gerechnet hat, sie zu bekommen, bzw. (was äußerst selten vorkommt) er traurig/nicht traurig ist, diese nicht bekommen zu haben.
7. Positionen (2) bis (6) werden jetzt mit einem weiteren Kandidaten durchlaufen.
8. Das Vorspiel: Der Händlerraum wird gezeigt. Es sitzen meist fünf Händler an einem gemeinsamen tresenartigen Möbelstück. Ist das Objekt zu groß, um vom Verkäufer mitgebracht zu werden, befindet es sich bereits vor Ort und es entspinnen sich erste Gespräche; Meinungen werden ausgetauscht. Schnitt auf einen Vorraum. Der Verkäufer gibt hier noch ein Statement ab, dass er sehr/kaum/gar nicht aufgeregt sei und es doch am besten wäre, wenn sich mehrere Händler für das Objekt interessierten und sich gegenseitig überböten. Der Onkel aus dem Off spendet noch ein paar begleitende Worte, gerne auch Wortspiele aus der untersten Schublade („… ob seine Modelleisenbahn wohl im Händlerraum ankommt oder auf dem Abstellgleis landet?“), während der Verkäufer sich in Richtung Händlerraum begibt (schön anzusehen, besonders, wenn es sich um ein Paar handelt, das vergeblich versucht, nebeneinander durch die engen Glastüren zu gehen).
9. Der Händlerraum: Der Verkäufer tritt ein, übergibt gegebenenfalls das Objekt und stellt sich auf den für ihn markierten Platz. Es gehen Begrüßungen und Informationen hin und her, bis schließlich der erste Händler ein Gebot abgibt, das meistens lächerlich weit von der Expertise entfernt ist. Mit etwas Glück entwickelt sich nun ein Bietergefecht, an dessen Ende einer der Händler das Objekt zugeschlagen bekommt (oder auch nicht, wenn der angebotene Ankaufspreis dem Verkäufer zu niedrig erscheint). Der vereinbarte Preis wird in Großaufnahme in großen (selten auch kleinen) Scheinen vorgezählt und übergeben. In Corona-freien Zeiten besiegelt ein Handschlag schließlich das Geschäft. Auch der Onkel aus dem Off gibt gerne noch einen onkelhaften Kommentar dazu („Zehn Euro über dem Wunschpreis. Prima.“)
10. Die Nachbereitung: Der Verkäufer geht, die Händler beglückwünschen sich gegenseitig zu dem tollen Objekt, das sie eine Minute vorher noch kleingeredet hatten („der Markt gibt das nicht her“, „vor zehn Jahren hätten Sie [...] dafür bekommen können“, „es wird schwer, dafür einen Käufer zu finden“, etc.). Der Verkäufer gibt im Vorraum ein weiteres Statement ab: dass er sehr/einigermaßen/weniger zufrieden sei und er mit dem Geld jetzt […] kaufen, lecker Essen gehen, oder einfach seine Reisekasse füllen werde.
11. Positionen (8) bis (10) werden nun mit dem Kandidaten aus (7) wiederholt.
12. Zweimalige Wiederholung von (2) bis (11) mit jeweils neuen Kandidaten.
13. Ende: Herr Lichter nimmt Bezug auf die Kinderei aus (1), bringt sie zu einem vermeintlich witzigen Abschluss und verabschiedet sich von den Zuschauern, oft mit Hinweis auf weitere spannende Folgen, die man sich in der Mediathek anschauen könne. Abspann, rockige Titelmelodie.
Ich hab' zu danken!
... eine der idiotischsten Phrasen der deutschen Sprache.
Aber da gibt es noch eine dritte Phrase, die auch in diesem Zusammenhang steht, nämlich: Was sagt man, wenn sich jemand bedankt hat? Da gibt es zahllose Möglichkeiten, zum Beispiel „bitte“, „gern geschehen“, „keine Ursache“ oder eine beliebige Kombination daraus. Und wenn man aus dem Norden kommt: „da nich für“. Am anderen Ende Deutschlands: „basst scho“.
Immer stärker setzt sich auch „gerne“ durch, was ich für vollkommen sinnentleert halte. „Vielen Dank“ – „Gerne.“ – gerne was?! Es verlangt ja keiner, dass man sich ganze Romane abringt, aber einfach nur „gerne“ finde ich doch ein wenig zu maulfaul.
Kommen wir jetzt aber zum absoluten Gipfel, dem Leuchtturm unter den Dankes-Erwiderungen: „Ich hab' zu danken“, mit besonders gewichtiger Betonung auf ich. Das hört man eigentlich nur von Händlern, wenn sie einen Kunden besonders elegant über den Tisch gezogen haben. Das lernen die anscheinend auf der Handelsschule, oder wo auch immer.
Die Übersetzung von ich habe zu danken lautet doch ich muss danken. Es handelt sich also lediglich um eine Feststellung, und noch nicht einmal um eine Absichtserklärung (ich werde danken), geschweige denn um einen tatsächlichen Dank (ich danke). Das lässt gleich mehrere Interpretationsmöglichkeiten zu: „ich muss danken und tue es hiermit“, „ich muss danken, tue das aber sehr ungern“, oder „ich muss danken, tue es aber nicht“.
Die erste klingt wachsbleich, amtsstubenhaft und hölzern. Die beiden letztgenannten wären in höchstem Maße flegelhaft und sind deshalb auszuschließen. Aber warum sagt man nicht einfach „Ich danke Ihnen“? Dieses alberne „Ich hab' zu danken“ treibt jedes Mal meinen Blutdruck in die Höhe und ich bin versucht zu sagen: „Ja, dann tun Sie's doch einfach!“.
Es gibt doch so viele andere Möglichkeiten, den Dank des Gegenübers gewissermaßen abzulehnen, indem man ihm zu verstehen gibt, dass man selber eigentlich zu Dank verpflichtet und ein Dank seinerseits somit nicht nötig sei, und man dieser Verpflichtung hiermit nachkomme, und zwar von ganzem Herzen. Es ist eine über hunderte von Generationen weitergegebene, immer wieder verfeinerte, hochkomplexe soziale Interaktion, deren Sinngehalt in „ich hab' zu danken“ komplett verloren gegangen ist.
Andere Sprachen haben hierfür ebenfalls gängige Floskeln erarbeitet: »You're welcome« sagt man in anglophonen Gegenden – Sie sind willkommen. »Prego« sagt der Italiener, was „ich bitte“ bedeutet. Die Spanier (de nada) und Franzosen (de rien) reden die Sache klein und behaupten einfach, es sei um nichts gegangen. Oder mit ähnlichem Inhalt, ebenfalls französisch, »pas de quoi«, was auch der Russe (не за что) kennt. Meines Wissens gibt es in keiner anderen als der deutschen Sprache dieses knöcherne, gedankenlose und unpersönliche „ich hab' zu danken“.
Kann das mal jemand diesen erbärmlichen Krämerseelen erklären? Danke! – Da nich' für.
Panade
... oder doch Panierung? Informationen für Besserwisser.
Gegen Anfang dieser Sendung erklärte er »für alle zum Mitschreiben« den Unterschied zwischen Panade und Panierung. Sinngemäß dozierte er:
| Panade* | Eine Panade ist ein Füll- und Lockerungsmittel, etwa aus eingeweichtem Weißbrot
oder Brötchen, für Hackmassen, gefüllte Kalbsbrust oder ähnliche
Gerichte. |
| Panierung* | Ein Schnitzel wird in Mehl, zerschlagenem Ei und Paniermehl gewendet und dann gegart. Anstelle von Paniermehl könnte auch Semmelbrösel oder Reibebrot stehen. Diesen Vorgang der Umhüllung nennt man Panieren, das Ergebnis der Tätigkeit ist die Panierung. |
In der verbliebenen Sendezeit hörte man jedes Mal, wenn jemand den
Begriff Panade mal wieder falsch benutzte, aus dem Hintergrund Herrn Lohse
„nierung“ murmeln. Seither ist mir der Mann sehr sympathisch und
ich tue es ihm gleich.
Seien wir ehrlich: Fast jeder sagt Panade,
wenn er Panierung meint – was es aber für Prinzipienreiter,
Klugscheißer und Besserwisser wie mich nicht richtiger macht. Ich bestehe,
seit ich im Besitz dieses fachsprachlichen Nuggets bin, stets darauf, die
goldgelbe, leicht soufflierte und knusprige Umhüllung eines
saftig-zarten Schnitzels Panierung zu nennen und sage das auch
jedem, der es nicht wissen will.
Gut, damit macht man sich keine
Freunde, aber es macht schon Spaß mit derlei Nischenwissen zu glänzen (bzw.
zu nerven). Probieren Sie's doch beim nächsten Schnitzel mal aus!


* Definitionen der Gastronomischen Akademie Deutschlands e.V..
Blues
... kennt jeder, hat jeder schon gehabt. Trotzdem eine Frage dazu ...
Während wir Deutschen, Franzosen, Italiener, Spanier und viele andere den/le/il/el Blues haben, haben die Amis (et al.), wenn man es linear übersetzt, die Blauen. Merkwürdig, dass sich das so falsch eingebürgert hat, finden Sie nicht? Und wenn man sich das erst einmal klar gemacht hat, bekommt man jedes Mal so ein komisches Gefühl am Hinterkopf, wenn mal wieder jemand behauptet, den Blues zu spielen.
Me and you are subject to the blues now and then hier könnte es noch Singular sein But when you take the blues and make a song hier auch noch You sing them out again hier nicht mehr
Fakt ist auch: You can't unthink it. Also machen Sie das Beste draus.
* Neil Diamond: Song sung blue (1972)
Von heißen Temperaturen ...
... ist ja im Sommer gerne mal die Rede. Aber gibt es so etwas überhaupt?
Und so kommt es dann auch immer wieder zu totalem Nonsens wie teuren Mieten, billigen Preisen, schnellen Geschwindigkeiten, schwerem Gewicht, weiter Entfernung, jungem Alter und ähnlich abstrusen Konstrukten.
Leute! Hirn einschalten beim Schreiben und Sprechen!

Niedrige Preise

Hohe Mieten

Große Entfernung
Ein Großdiscounter könnte beispielsweise durchaus auf die Idee kommen, mit „Ab Montag noch billigere Preise“ zu werben, aber dennoch nichts zu verändern. Denn er hat ja nicht behauptet, dass ab Montag alle angebotenen Waren billiger werden, sondern lediglich die Preise (wie auch immer das gehen soll). Keine Sorge, das wird nicht passieren, denn die Kundschaft ist auf diese Art von Dummdeutsch bereits konditioniert und hätte keinerlei humorvolles Verständnis für derlei Winkelzüge. Lidl/Penny/Aldi würden sich also selbst einen Bärendienst erweisen.
Teure Mieten sind auch wieder so ein Slogan, der sich ungeprüft festgesetzt hat. Niemand würde von teuren Kosten sprechen – und der Mietzins gehört nun einmal zu den Kosten. Das, wofür wir Miete bezahlen ist die kostenpflichtige Überlassung von Wohnraum. Sozusagen die Genehmigung, das Eigentum des Vermieters nutzen zu dürfen. Und die ist teuer, nicht die Miete.
Dass allerdings ein Elektroingenieur, und zwar bereits 1932, elektrische Hochleistung auf weite Entfernung übertragen wollte, lässt sich eigentlich nur damit erklären, dass er in einer Zeit lebte, in der Pathos zur Alltagssprache gehörte. Auf weite Entfernung: Man sieht quasi vor dem inneren Auge die Weite der wogenden Wälder, der silbernen Seen, der lockenden Landschaften ... Und auf diese Weise bekommt man selbst in den Titel eines Fachaufsatzes etwas Leidenschaft. In der heutigen, sehr viel nüchterneren Zeit hieße es wahrscheinlich „Übertragung elektrischer Hochleistung über große Distanzen“. Nichtsdestoweniger gibt es weite Entfernungen einfach nicht.
Fazit: Wir alle sollten unsere Muttersprache mit etwas mehr Sorgfalt behandeln, sonst erreichen wir den Zustand der Beliebigkeit mit überaus schneller Geschwindigkeit.
Xavier Naidoo!
Fridays For Future → F F F → 6 6 6 → Was???
Original-Zitat: „Es ist heute der 20. September, ein sogenannter Friday for Future. F F F. Dreimal F. F ist am sechsten Platz im Alphabet [zählt an den Fingern mit] A, B, C, D, E, F. Dreimal F in dem Fall. 6 6 6. Und ähh, auf jeden Fall, da weiß man auch wieder, wer dahinter steckt.“
Das Tier? Der Antichrist? Der Teufel, Satan, Beelzebub? Dunkle Mächte? Außerirdische? Ich wittere Verschwörung!
Mein Vorschlag dazu: Kauf Dir 'ne Rolle Alufolie. Bau dir 'nen Helm draus. Stylische Sonnenbrille und Handschuhe hast Du ja schon. Mehr kann man dazu echt nicht sagen.
Oder doch: Dass man einen Irrläufer wie Dich überhaupt in diese sogenannte Jury bei DSDS* aufgenommen hat, ist mir unverständlich. Der Rauswurf war daher keine Überraschung. Es war schließlich nicht das erste Mal, dass Du wirres Zeug von Dir gabst. Ich bezeichne Dich jedoch weder als Rassisten noch als Zeloten. Nein, Du bist einfach verwirrt und solltest professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Von Fernsehen und sozialen Netzwerken halte Dich bitte künftig fern.
Danke. Ich wünsche gute Besserung.
* Deutschland sucht den Superstar, Unterhaltungssendung beim Privatsender RTL.
Atemalkoholsensoren
Vom Parsen und über die Vorzüge des Bindestrichs.
Vielleicht wussten Sie's noch gar nicht: Beim Lesen geschieht etwas im Kopf, das die Wissenschaft parsen (ich parse, habe geparst, parste) nennt. Das ist der Vorgang, bei dem aus einem Haufen Buchstaben Sinn gewonnen wird. Nehmen wir als Beispiel den Begriff in der Überschrift. Je nachdem, mit welchem Thema sich das Gehirn kurz zuvor beschäftigt hat, untersucht es das Wort vielleicht zunächst einmal bis Atemal. Jetzt wird in der hirn-eigenen Bibliothek nach diesem Ausdruck gesucht, nichts gefunden und ein Vermerk hinterlegt („mal bei Google nachschlagen“).
Neuer Versuch: Weiter hinten findet man ja auch noch holsen (könnte ein Name sein), oder sogar koholsen (also ein Mitarbeiter von Holsen). Dann bleiben noch ein paar Dänen o.ä. übrig (soren). Das Ganze wird dann einer Plausibilitätsprüfung unterzogen, für Unsinn befunden, und es geht zurück zum Wortanfang.
Und so nach und nach dämmert uns dann, dass es sich um Atem-Alkohol-Sensoren handeln könnte. Dieser Vorgang des Parsens benötigt im Extremfall einige Sekunden und bindet unglaubliche Mengen an Energie und Konzentration. In einem realen Sinne ist dieser Vorgang ermüdend.
Doch hier kommt unser Held, der Bindestrich (alias Viertelgeviertstrich oder Divis) ins Spiel:
Kaum findet unser Parser einen solchen Bindestrich, weiß er, dass eine logische Einheit abgeschlossen ist und er sich dem nächsten Abschnitt widmen kann. Kein zeitraubendes Hin und Her, kein Noch-mal-von-vorne. So können auch Missverständnisse von vorneherein vermieden werden: Die berühmten Blumento-Pferde geben sich sofort als Blumentopf-Erde zu erkennen. Der Unterschied zwischen Buschfeuern und Buschauffeuren wird durch die Trennung sofort offenbar. Der Politikersatz wird sogar erst durch einen Bindestrich eindeutig: Entweder Politik-Ersatz oder Politiker-Satz. Ebenso verhält es sich mit Spielende, Staubecken und Versendung.
Ich kann nur dazu aufrufen, unübersichtliche Wörter so weit und so oft wie möglich aufzutrennen. Es hilft enorm bei der Sinnerfassung. Lese ich beispielsweise etwas über unseren ehemaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher und anschließend einen Artikel über Bio-Technologie, in dem mehrfach der Begriff Genschere vorkommt, dann kann es schon etwas länger dauern, bis sich das Wort Gen-Schere zu erkennen gibt. Dem Verfasser des Artikels, der sich ja intensiv mit dem Thema befasst hat, erschiene das vielleicht unsinnig und weit hergeholt – wahrscheinlich hat er gar nicht darüber nachgedacht: Aber für mich wäre ein Bindestrich hier eine deutliche Erleichterung gewesen. Ähnlich erging es mir wenig später mit der Eigelbremoulade, Eigel-bremoulade, nein Eigelb-Remoulade.
Das soll jetzt aber dem Deppenbindestrich nicht Tür und Tor öffnen. Die Gartenpforte bekomme ich ebenso wie den Parkplatz und den Staubsauger problemlos auch ohne diese Lesehilfe bewältigt. Ich denke da eher an so pikante Wörter wie die Salonalbumserie* ...
* siehe hierzu auch: E.C. Hirsch Deutsch für Besserwisser, Verlag Hoffmann & Campe 1976
Weniger ist mehr...
... glauben ja viele. Aber ist das auch tatsächlich so?
Diese Phrase haben Sie doch bestimmt auch schon mal gehört: „... man sagt ja immer: »weniger ist mehr« ...“. Da frage ich mich dann doch ab und zu, wer man ist und warum er das immer sagt. Zumal das ja auch gar nicht stimmt: Weniger ist weniger und mehr ist mehr. Und zwar immer.
Die pauschale Aussage »weniger ist mehr« stimmt so einfach nicht. Es kann durchaus sein, dass weniger a mehr b ergibt. Aber dann sagt man eher: Je weniger Wasser desto mehr Trockenheit. Je weniger Autos desto mehr Parkplätze. Je weniger Doofe desto mehr Lebensfreude.
Meistens ist »weniger ist mehr« jedoch ganz anders gemeint:
„An der Gans ist leider etwas zu viel Majoran. Weniger wäre mehr gewesen.“ „Fahren Sie nach einem Kaltstart nicht sofort mit Vollgas. Weniger ist in diesem Fall mehr.“ „Auf keinen Fall zu viel gießen. Weniger ist hier mehr.“
Weniger ist hier nicht mehr sondern besser – und so ist es auch in den allermeisten anderen Fällen gemeint. Die Wurzel des Übels liegt in einem allgemeinen Trend: Kaum jemand spricht noch in ganzen, zusammenhängenden Sätzen. Inhaltsleere Slogans ersetzen komplexe Aussagen: »Weniger ist mehr«*, »genug ist genug«, »wenn schon denn schon« und »früher war mehr Lametta«. Besser wären natürlich präzise Hinweise:
„An der Gans ist leider etwas zu viel Majoran. Dadurch wird der delikate Eigengeschmack übertönt.“ „Fahren Sie nach einem Kaltstart nicht sofort mit Vollgas. Der Schmierfilm könnte abreißen und zu einem Motorschaden führen.“ „Auf keinen Fall zu viel gießen. Dadurch bildet sich Staunässe, die diese Pflanze nicht verträgt.“
... aber das überschreitet dann wohl die Aufmerksamkeitsspanne der meisten Zuhörer bzw. Leser.
Was kann man tun? Ein Anfang wäre bereits gemacht, wenn die Leute sich beim Sprechen nur mal selbst zuhörten. Hinreichende Selbstkritik und Einsichtsfähigkeit vorausgesetzt, verzichteten sie dann vielleicht gerne auf die eine oder andere sinnlose Floskel – denn weniger ist einfach weniger.
* Übrigens: Gibt man »weniger ist mehr«
mal bei Google
Ngram Viewer ein fällt auf, dass sich diese Weisheit erst so richtig
seit den Neunzigerjahren durchgesetzt hat.
Außerdem gilt: Bei
Ebbe ist weniger Meer ...
Ein bisschen Glück
Haben Sie schon mal was per Anruf beim Privatfernsehen gewonnen? Nein? Na, da fehlt Ihnen wahrscheinlich nur ein bisschen Glück.
Privatsender sind ja stets auf der Suche nach Einnahmequellen. Sei es durch die unerträgliche Werbung, die mittlerweile schon epidemische Ausmaße angenommen hat, oder durch irgendwelche dümmlichen Mitmachspielchen, bei denen man anrufen („nur 50 ct. pro Anruf!“) oder eine SMS („nur 50 ct. pro SMS“) schicken soll. Durch bloße Nennung eines Kennwortes und mit ein bisschen Glück* kann man da nicht selten tausende von Euros gewinnen („per Blitzüberweisung: Geld ist am nächsten Tag auf dem Konto“).
Ein bisschen Glück, pah, ich kann's echt nicht mehr hören. Was ist eigentlich ein bisschen Glück? Wenn sich die Nadel der Tankuhr in den roten Bereich begibt und ich noch vierzig Kilometer bis zur nächsten Tankstelle habe, dann komme ich mit ein bisschen Glück dort auch an. Wenn zum Familienfest unangemeldet Tante Hedwig und Onkel Otto erscheinen, dann bekomme ich die mit ein bisschen Glück (und etwas kleineren Kuchenstücken) auch noch versorgt. Ich habe also eine ungefähre Fifty-fifty-Chance auf einen erfolgreichen Ausgang. Und ein bisschen Glück reicht, um auf der Schicksalswaage zu meinen Gunsten zwei, drei Gramm aufzulegen.
Wie seht es denn nun mit dem bisschen Glück beim Privatsender aus? Haben die etwas zu verschenken? Klare Antwort: Nein! Wenn da meinetwegen 5.000 Euro ausgelobt werden, woher kommt denn das Geld? Klare Antwort: Von den dämlichen Anrufern, die auf ihr bisschen Glück vertrauen – und auch gerne zwei- bis zehnmal anrufen, um ans große Geld zu kommen. Der Sender rückt die Kohle sowieso erst raus, wenn mindestens zehntausend (gleich 5.000 Euro) Anrufe eingegangen sind. Vermutlich wage ich mich nicht zu weit vor, wenn ich behaupte, dass die Auszahlung gar erst bei hundert- bis zweihunderttausend Anrufen erfolgt (wenn überhaupt).
Eine 1:100.000-Chance auf 5.000 Euro klingt ja zunächst mal auch gar nicht so schlecht. Aber ich bin dennoch der Meinung, dass hier ein bisschen Glück nicht mehr ausreicht. Man benötigt schon massiv viel Glück, wenn man bei so einem »Spiel« gewinnen möchte. Dieses Kleingerede bringt mich jedes Mal auf die Palme. Warum sagt man den Zuschauern nicht, dass ein bisschen Glück eben nicht ausreicht, und dass es im Gegenteil absoluter Quatsch ist, sich an solchen Gewinnspielen zu beteiligen?
Laut Gesetz starren mich von jeder Zigarettenschachtel krankhaft veränderte Atemwegsorgane an. Laut Gesetz muss ich darauf hingewiesen werden, dass ich meinen Arzt oder Apotheker zu Risiken und Nebenwirkungen frei verkäuflicher Medikamente befragen soll. Laut Gesetz müssen Allergene in Lebensmitteln deklariert werden. Alles zum Schutze des mündigen Bürgers. Aber hier? Noch nicht einmal ein flüchtig hingenuscheltes „Glücksspiel kann süchtig machen, Teilnahme erst ab 18“. Keine Bekanntgabe der Gewinnchance, oder wenn doch, dann im Winzigkleingedruckten, das innerhalb von 0,5 Sekunden am unteren Bildschirmrand durchläuft. Wie kann das sein?
Die Antwort liegt auf der Hand: Der Sender verdient daran, der Telefondienstanbieter verdient daran, der Staat verdient daran, niemand klagt, und mit ein bisschen Glück für die Verdiener und Mitverdiener wird das auch noch lange Zeit so bleiben ...
* Übrigens: Man kann beides sagen: »mit ein bisschen Glück« oder »mit einem bisschen Glück«. Mit »ein wenig« geht das seltsamerweise nicht.
Doppel-Moppel
Redundanz trägt zwar oft zur besseren Verständlichkeit bei, aber bisweilen kann sie ganz schön nerven.
Neulich hat mal wieder so ein Fernsehkoch eine Sauce einreduziert. Er gebrauchte dieses Wort mehrfach und mit großer Begeisterung. Wenn man sie erst einmal zusammenaddiert hat, kann man die Einzelkomponenten dann nicht mehr auseinanderdividieren, da die Flüssigkeit schon abgebunden ist.
Immer mehr Sabbelköppe möchten uns ihr wirres Deutsch aufoktroyieren. Derlei überflüssige Vorsilben könnten sie aber auch einsparen (oder deren Anzahl doch wenigstens herabmindern). Man könnte auch schlussfolgern, dass eine Abänderung dieser Angewohnheit wieder mehr Klarheit in die Sprache brächte: Reduzieren, addieren, Komponenten, dividieren, binden, oktroyieren, sparen, Zahl, mindern, folgern, Änderung, Gewohnheit. Mehr Präzision geht nicht. Verdoppelung steigert den Informationsgehalt nicht, sondern trübt ihn.
Das wollte ich nur mal kurz angemahnt haben.
Knottschies
Seit dem Einzug der mediterranen Gourmet- in die deutsche Einbauküche tauchen immer wieder Fragen zu Aussprache, Genus und Numerus der Zutaten auf.
Hier einige Beispiele dazu aus dem italienischen Sprachraum:
- Die Zucchini: Spricht sich Zuckieni [tsʊˈkiːni]
und nicht Zuschieni. Allerdings ist das die Pluralform. Der (italienische) Singular dazu lautet lo zucchino. Das
ist der Diminutiv zu lo zuccho – der Kürbis. Zucchini sind
dem Wortsinn nach also kleine Kürbisse. Und genau wie der Kürbis ist auch der Zucchino
von männlichem Genus*. Vermutlich wird man Sie jedoch
verständnislos anschauen, wenn Sie im Gemüsefachgeschäft einen Zucchino
verlangen. Daher mein Rat: Immer mindestens zwei Zucchini
verlangen, dann gibt's
auch keine Probleme. Genaugenommen müsste es sogar zwei Zucchinos heißen,
da sich die Bildung des Plurals bei jedem Wort eigentlich nach der
deutschen Grammatik zu richten hat. Dem Duden ist das Wurscht. Dort findet
sich die oder der Zucchini, und als »verwandte Form« auch der
Zucchino. Und der Plural lautet stets die Zucchini (und
nicht Zuschienis).
- Der Radicchio: Mit vollem Namen Radicchio Rosso
di Chioggia, ein rot-weißer Verwandter des Chicorée mit ausgeprägten
Bitternoten. Spricht sich Radickio [raˈdɪki̯o],
was sogar leider die wenigsten Profiköche zu wissen scheinen: „Da neh'ma an
Raditscho her, an Ingwa und a Fanill'schot'n ...“
- Die Spaghetti: Spricht man [ʃpaˈɡɛti]
oder auch [spaˈɡɛti]. Das Problem ist ähnlich wie beim Zucchino gelagert: Gli
spaghetti ist eigentlich die Pluralform von lo spaghetto.
Der Singular müsste also der
Spaghetto heißen – aber wer braucht schon einen einzigen? Auch spaghetto
ist wieder eine Diminutivform und bezeichnet eine kleine Schnur (spago). Duden meint, dass
der Singular von die Spaghetti »die Spaghetti« ist. Er
erlaubt uns sogar, das h
wegzulassen, was sich dann aber
eigentlich [spaˈdʒɛti] ausspräche und Quatsch mit
Spaghettisoße wäre.
Grammatikalisch richtig wäre
der Spaghetto, die Spaghettos. Aber erzählen Sie das
mal der Duden-Redaktion.
- Die Gnocchi: Sind, genau wie die Spaghetti, selten
allein. Außerdem: Die Njocki [ˈɲɔkːi] – kleine Klößchen (Nocken) aus Kartoffeln
oder Hartweizengrieß – heißen schon mal gar nicht Knottschies. Und eines davon heißt
Gnoccho [ˈɲɔkːɔ]. Wenn man das weiß, hat man gegenüber
ca. 95% der Restbevölkerung
einen eklatanten
Wissensvorsprung.
Ein Großteil der verbleibenden
5% hat vermutlich
den Film »Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem
schlief« gesehen – Serafina (verführerisch): „Gnocchi!“ ...
Windisch (betört): „Gnocchi!“.
- Das Ciabatta: Wird nicht unter Verwendung von
Chia-Samen [tʃia…] hergestellt und heißt
deshalb auch nicht Tschiabatta sondern Tschabata [tʃa'bat:a].
Das stumme i bewirkt lediglich, dass das C
nicht wie ein K ausgesprochen wird. Duden informiert:
„italienisch ciabatta, eigentlich = Pantoffel (nach
der Form). Älter türkisch çabata = Stiefel, aus dem Persischen“. Hätten Sie's
gewusst?
- Die Salami: Sie ahnten es bereits
– es ist eine Pluralform. Die Wurst heißt il salame, und
erst in der Mehrzahl werden i salami daraus. Warum meinen wir nun
also, dass die Salami nur eine einzelne ist? Man weiß es nicht; es hat sich
einfach durchgesetzt und
eingebürgert. Duden sagt dazu: „die Salami;
Genitiv: der Salami, Plural: die Salami[s],
schweizerisch auch: der Salami;
Genitiv: des Salamis, Plural: die Salami“. Eigentlich richtig wäre der
Salame, die Salamen – ist aber in Wirklichkeit falsch.
- Das Carpaccio: Gesprochen Karpatscho [karˈpatʃo].
Ist laut Duden eine „kalte [Vor]speise
aus rohen, dünn geschnittenen, mit Olivenöl und geraspeltem
Parmesankäse angemachten Scheiben von Rindfleisch [oder Fisch bzw. Gemüse]“. Um es mal
klar zu sagen: Hier irrt der Duden. Einen wichtigen Hinweis
gibt Wikipedia: „Entwickelt wurde es im Jahr 1950 in Harry’s
Bar in Venedig von deren Inhaber Giuseppe Cipriani
[...]. Cipriani benannte seine Kreation nach dem berühmten
venezianischen Maler Vittore Carpaccio, der für seine
leuchtenden Rot-/Weißtöne bekannt war [...]“. Wer
hat schon mal leuchtende Rot-/Weißtöne bei Fisch oder Gemüse
gesehen?
Nein, ein echtes Carpaccio (Plural: die Carpaccios) besteht
aus rohem, hauchfein geschnittenem Rindfleisch, Olivenöl,
Parmesanraspeln und vielleicht noch etwas Zitronensaft.
Punkt. Keine roten Bete, kein Lachs, keine Vinaigrette, kein Pesto, keine Nüsse
und schon mal ganz bestimmt kein Rucola. Merken!
- Die Pizza: Stellt im Singular kein Problem für die
deutsche Zunge dar (obwohl das i gerne etwas länger
ausgesprochen werden könnte). Erst wenn man mehrere davon möchte, geht das
Gedruckse los. Sagen wir's mal so: Auch hier gehen Theorie und Praxis
verschiedene Wege. Der Italiener sagt einfach le pizze. Wenn man
nun davon ausgeht, dass Pizza ein deutsches Wort ist (denn es wird ja
innerhalb der deutschen Sprache benutzt und groß geschrieben), dann ist die
Pizzas die einzig richtige Pluralform. Der Duden – mal wieder lieber
deskriptiv als präskriptiv – lässt daneben aber auch die Pizzen
gelten. Die Pizza
Margherita, die bei jedem Lieblings-Italiener immer ganz oben
auf der Pizza-Karte steht und immer die billigste ist (genau wie in der Tiefkühlabteilung
des Supermarktes) gehört übrigens zum Edelsten, was Italien
zu bieten hat – aber eben leider nur in Napoli ...
- Der Espresso: Den bestellt man beim Lieblingsitaliener nach dem Essen. Er heißt übrigens nicht Expresso, da der kurze Heiße nicht schnell (express) gemacht, sondern ausgedrückt (espresso) wird. Was ist nun aber mit zweien davon? Zwei Espresso, oder doch zwei Espressi? Grammatikalisch richtig wäre »Espressos«, da der Singular »Espresso« ist. Duden weiß: „Plural: die Espressos oder Espressi (aber: drei Espresso)“. Wollen Sie jedoch perfekt italienisch bestellen, sagen Sie einfach „due caffè per favore“, denn espresso sagt eh kein Italiener, wenn er Kaffee meint.
Buon appetito!

Der richtige Singular: In Italien produzierte Wurstspezialität mit Fenchelsamen.
Die Farben Italiens: Basilikum, Mozzarella und Tomaten versammeln sich auf der Pizza Margherita.

Nix Espresso: Der Italiener nennt ihn schlicht und ergreifend caffè.
* Genus (nicht zu verwechseln mit Genuss) ist das grammatische Geschlecht eines Wortes, also männlich, weiblich oder sächlich (maskulin, feminin oder Neutrum).
Zigzig
Die Kombination von Zahlen und Buchstaben zu einem sinnvollen Wort fällt vielen Deutschen anscheinend schwer.
Stolpern Sie auch öfter mal über so merkwürdige Dinge wie den »50zigsten Geburtstag«, die »70ziger Jahre«? Wurden Sie schon einmal gefragt, ob Sie einen »100erter« wechseln können oder würden Sie sich für eine schicke »1000ender Kawasaki« begeistern? Alles völlig normal? Dann fangen wir nochmal von vorne an.
Was ist am »50zigsten Geburtstag« zu bemängeln? Ganz einfach: 50 ist fünfzig. Und 50zig ist fünfzigzig. Der Hunderter wird zum Hunderterter und der Tausender zum Tausendender (der feuchte Traum eines jeden passionierten Rotwild-Jägers).
Grundsätzlich unterscheiden wir im Deutschen (und den meisten anderen Sprachen) zwischen Kardinalzahlen und Ordinalzahlen. »Fünfzig« bzw. »50« ist eine Kardinalzahl. Die dazu passende Ordinalzahl ist »fünfzigste/r/s« oder »50.«. Ein einfacher Punkt macht also aus einer Kardinal- eine Ordinalzahl. Das »zigste« kann (und sollte) man sich sparen.
Der Duden erlaubt uns, die »Siebzigerjahre« auch »70er Jahre« zu schreiben. Aber ohne überflüssiges »ziger«. Ebensowenig sollten 50er, 100er und 1000er verunstaltet werden. In verschiedenen Internet-Foren ist mir sogar der »1000sender« schon mehrfach begegnet. Ein besonders sinnloses und hässliches Exemplar wie mir scheint.
Gegen derlei Auswüchse hilft eigentlich nur eines: Sich das Geschriebene einmal laut vorlesen. Aber bei manch einem gelingt das wohl weder beim 1sten, noch beim 100erdsten Mal.
Trümmer
Ein Ausflug in die Trümmerlandschaft der deutschen Gegenwartssprache.
Immer häufiger höre ich in letzter Zeit den Ausdruck »so ein Riesentrümmer«, oft zeitgleich mit einer beidhändigen Geste, die – ähnlich wie unter Anglern üblich – das Ausmaß des »Riesentrümmers« darstellt. Da frage ich mich jedes Mal, wo derjenige wohl Deutsch gelernt haben mag. Klären wir doch mal ein paar Begriffe:
- Die Trümmer (Substantiv, Neutrum, Plural). Singular dazu: Das Trumm (österreichisch umgangssprachlich, sonst landschaftlich, Kluge nennt es »bairisch«) ist ein großer Brocken, ein unhandlicher Gegenstand.
- Die Trümmer oder Trumme (Substantiv, maskulin oder Neutrum, Plural). Singular dazu: Der oder das Trumm ist im Bergbau ein kleiner Gang oder ein Teil einer Förderanlage. Andere Schreibweise, gleiche Aussprache: „Trum/Trume/Trümer“.
- Die Trümmer (Substantiv, Pluraletantum) sind Bruchstücke, Schutt, Überreste. Einen Singular zu diesem Wort gab es früher einmal – siehe [4.] – er existiert aber im Neuhochdeutschen nicht mehr.
- Die Trümmer (Substantiv, feminin, Singular) war im 18. und 19. Jahrhundert einmal der Singular von [3.], also ein Bruchstück, ein Überrest.
Halten wir also fest: »Den oder das Trümmer« gab und gibt es nicht. In den allermeisten Fällen dürfte »das Trumm« aus [1.] gemeint sein. Das alles kann man z.B. bei www.duden.de oder in klugen Büchern nachlesen ... und sich dann erneut fragen, was denn ein »Riesen-Trümmer«, ein »riesen Trümmer« oder ein »Riesentrümmer« sein könnte – selbst über die Rechtschreibung scheint im weltweiten Netz Uneinigkeit zu herrschen. Aber auch hier hilft uns die Duden-Redaktion gerne weiter: Einzig richtig (gäbe es ihn denn) ist der Riesentrümmer. Gleiches gilt auch für den Mordstrümmer. Denn unsere Rechtschreibregeln gelten auch für Wörter, die gar nicht existieren!
Über Geschmack ...
... kann man bekanntlich nicht streiten. Was aber ist ein Geschmäckle?
Er begegnet uns seit einiger Zeit wirklich überall: Der kleine Geschmack – das Geschmäckle. Journalisten, Politiker, Promis – alle benutzen es. Ein jegliches, das früher einen faden Beigeschmack oder gar Hautgout hatte, anrüchig oder dubios genannt wurde, hat heutzutage ein »Geschmäckle«.
Was ist das überhaupt für ein Wort – Geschmäckle? An der Endung -le lässt sich mit hoher Sicherheit ein schwäbischer Ursprung ablesen. Im Land der Häuslebauer und Pfennigfuchser, wo eine Hand die andere wäscht, wo man »zamma khörd«, wo die Vedderleswirdschafd fröhliche Urständ feiert, wo man Vierdele trinkt und Schbäddzle mampft, da hat ein kleines Gschäfdle knapp am Rande der Legalität und guter Sitten eben keinen Geschmack, sondern ein Gschmäggle.
Ja, richtig: Hinter das Anfangs-G gehört kein e. Wenn schon schwäbisch, dann auch richtig. Aber wozu überhaupt? Versucht der Sprecher damit sein Sprachtalent unter Beweis zu stellen? Macht er sich augenzwinkernd mit dem Schwaben und seiner Lebensphilosophie gemein? Oder ist das bloß mal wieder so ein total bescheuertes Modewort? Wie auch immer; was auch immer: falsch ausgesprochen klingt es eigentlich nur peinlich.
Also: Entweder Geschmäcklein (wie putzig), oder Gschmäggle. Wer das nicht aussprechen kann [ˈkʃmɛglə], der benutze bitte weiterhin das alteingeführte Wort Beigeschmack. Denn: „Wer schwäbische Wörter nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Maultaschen nicht unter zwei Portionen bestraft“. Vrschtosch mi?!
Lounge
Sie kennen den Unterschied zwischen Lounge, Longe, Lunch und Launch? Da haben Sie dem Großteil Ihrer Landsleute etwas voraus.
Ich will jetzt hier nicht im einzelnen darauf eingehen, wer was wo gesagt hat, denn das Phänomen ist leider allgegenwärtig. Schauen Sie sich nur mal Fernsehsendungen an, in denen regelmäßig und mit einigem Stolz die Innenarchitektur der eigenen vier Wände präsentiert wird. Wie z.B. »Das perfekte Dinner« auf VOX. Da gibt es in der Guten Stube meistens eine ausgedehnte Wohnlandschaft (früher: Eck-Sofa), die sehr gerne mit weiter Geste zum »Longe-Bereich« hochstilisiert wird, dann wieder zum »Launch-Bereich«, oder tatsächlich zum »Lunch-Bereich« ... Wirklich? Wenn man schon meint, so schicke neudeutsche Lehnwörter benutzen zu müssen, dann aber doch bitte richtig:
Wort
Definition lt. Duden
Herkunft
Aussprache
Lounge
- Gesellschaftsraum in einem Hotel o. Ä.; Hotelhalle.
- Bar, Klub mit anheimelnder Atmosphäre.
- Luxuriös ausgestatteter Aufenthaltsraum auf Flughäfen, in Bahnhöfen, großen Stadien o. Ä.
Englisch [laʊ̯ndʒ] Longe
- (Reiten) sehr lange Leine, mit der ein Pferd im Kreis herumgeführt und dabei dressurmäßig korrigiert wird.
- (Turnen, Schwimmen) an einem Sicherheitsgurt befestigte Leine zum Abfangen von Stürzen bei gefährlichen Übungen oder beim Schwimmunterricht.
Französisch [ˈlɔ̃ːʒə] Lunch (in den angelsächsischen Ländern) kleinere, leichte Mahlzeit in der Mittagszeit. Englisch [lʌntʃ] Launch Einführung eines neu entwickelten Produktes auf dem Markt. Englisch [lɔːntʃ]
Also, liebe Häusle-Präsentierer: Eure federkerngepolsterte Möbel-Diskounter-Lümmellandschaft zum Super-Schnäppchenpreis könnte man mit viel gutem Willen einen Loungebereich nennen. Das spricht sich Laundsch. Wenn das so schwer zu begreifen ist, dann sagt doch einfach wieder »Eck-Sofa«. Das trifft's dann auch in den meisten Fällen viel besser.
#Hackfleischplakette
Mittlerweile kann man kaum noch irgendwas lesen, ohne über #Hashtags zu stolpern. Ich finde das #lästig.
Wozu soll dieser Mist eigentlich gut sein? Es stört den #Lesefluss und ich weiß nicht, wie ich dieses komische Zeichen lesen soll, das hier regelwidrig ohne Leerzeichen einfach vorne an jedes beliebige #Wort drangebatscht wird. Vielleicht einfach einen Halbton höher?* Wäre ich bei #Twitter, könnte ich das ja noch verstehen – die haben diesen #Hashtag (zu Deutsch: #Gehacktesanhänger, #Haschischetikett oder auch #Doppelkreuzmarkierung) quasi erfunden. Verschlagwortung heißt der Vorgang wohl.
Aber neuerdings findet sich dieser Quatsch in jeder Zeitung (wo er nicht nützt), im Fernsehen (wo er genauso wenig nützt) und sogar in der Werbung (wo er zudem auch noch niemanden interessiert). Ich fühle mich dadurch belästigt. Ich will nicht dauernd nutzlose Zeichen lesen, die nichts zum #Informationsgehalt beitragen.
Schönes Beispiel: Das WDR3 Abendprogramm vom 13.09.2018.
20.15: #jahrhundertsommer - Sonne satt und Schattenseiten. Doku D 2018 21.00: #weltuntergang - Der Sommer, der ins Wasser fiel. Reportage
Wo liegt der Nutzwert dieser Hashtags? Kann man die nicht einfach weglassen und das folgende Wort regelkonform groß schreiben? Ist das jetzt chic, trendy, angesagt? Steuern diese Doppelkreuze irgendeine relevante Information bei? Warum muss es „Häschtäck jahrhundertsommer“ heißen? Ist man ausgestoßen, ewiggestrig, out, wenn man den Marker einfach weglässt, ihn eventuell sogar durch einen Artikel ersetzt? »Der Jahrhundertsommer - Sonne satt und Schattenseiten«. Kann man für meinen Geschmack so lassen.
Ich kann der Täggerei nichts abgewinnen. Mich nervt das. Belasst die #Kreuzchen bei Twitter. Da gehören sie hin und da stören sie mich auch nicht weiter. Ich rufe hiermit zum #Hashtagboykott auf!
* Für Nichtmusiker: Das Kreuz ♯ bezeichnet in der Musik die Erhöhung eines Stammtons um einen Halbton.
Kreieren
Das neue Lieblingswort aller Fernseh-, Radio-, Internet- und Print-Journalisten muss auf Teufel komm raus in jede Reportage eingebaut werden. Das kreiert ein Problem.
Und zwar für mich. Mir geht diese neue Kreativität nämlich momentan ziemlich auf den Geist. An allen Ecken und Enden wird kreiert, dass es nur so eine Art hat. Besonders, wenn es um Übersetzungen aus dem Englischen bzw. Amerikanischen geht. Dort wird ja noch viel mehr kreiert als hier – und da kommt es vermutlich auch her: „Schief ist englisch und englisch ist modern“. Kreieren ist hip, kreieren ist in.
Allein schon das Schriftbild finde ich scheußlich: kreieren liest sich im ersten Anlauf immer wie »krei'eren«. Dann muss man innehalten, wieder zurück und nochmal richtig lesen: »kre'ieren«. Im Duden ist kreieren nicht einfach nur „machen“ sondern ganz explizit:
- (bildungssprachlich) (eine neue Mode) schaffen, gestalten, erfinden
- (bildungssprachlich) als Eigenes, eigene, persönliche Prägung o. Ä. hervorbringen
- (Theater) eine Rolle als Erste[r] spielen
- (katholische Kirche) zum Kardinal ernennen
Man mache sich nur einmal die Mühe und gebe „kreiert“ bei google.de ein. Hier einige Highlights:
Er glaubt nicht, dass die Digitalisierung nur Profiteure kreiert. Wer kreiert Namen für neu erfundene Dinge? Formel E kreiert Mini-Europameisterschaft. Denn Helden werden nicht dadurch kreiert, dass sie taktisch und mannschaftlich klug Platz machen [...] Jedes Problem wurde vom Verstand kreiert und besteht, solange der Geist daran festhält. Die grundlegendste Möglichkeit, eine Torchance zu kreieren, ist der Spielaufbau.
Also: entweder ist es bildungssprachlich, was wir wohl bei den meisten hier gezeigten Beispielen ausschließen dürfen, oder es hat was mit Theater oder Ecclesia Catholica zu tun, was hier ebenso nicht der Fall zu sein scheint. Aber wie kann Digitalisierung Profiteure kreieren? Wie können Helden, Europameisterschaften, Torchancen oder (am weitesten verbreitet) Probleme kreiert werden? Kreieren hat doch immer etwas mit Kreation oder Kreativität zu tun – dem Schaffen von Dingen. Und genau deshalb kann man weder Menschen (Profiteure, Helden), noch Immaterielles (Probleme, Torchancen) kreieren. Das Wort ist hier einfach fehl am Platz. War kreieren anfangs noch ein unreflektiert übernommener und falsch verwendeter, jedoch selten auftretender Anglizismus, so hat es sich heute aller Fesseln entledigt und ist – egal, ob sinnvoll oder sinnfrei – allgegenwärtig.
Aber gibt es denn eventuell Möglichkeiten, unsere Beispielsätze zu ent-kreieren? Versuchen wir's:
Er glaubt nicht, dass die Digitalisierung nur Profiteure hervorbringt. Wer denkt sich Namen für neu erfundene Dinge aus? Formel E führt Mini-Europameisterschaft ein. Denn Helden werden nicht dadurch geschaffen, dass sie taktisch und mannschaftlich klug Platz machen [...] Jedes Problem wurde vom Verstand erzeugt und besteht, solange der Geist daran festhält. Die grundlegendste Möglichkeit, eine Torchance zu erarbeiten, ist der Spielaufbau.
Man sieht: Auch ohne das schicke neue Modewort kreieren kann man mit etwas Kreativität ganz normale deutsche Sätze kreiereiereieren.
Und ... ja
Manche Leute wissen einfach nicht, wie man Aufzählungen ordnungsgemäß über die Bühne bringt. Das kann für Zuhörer recht anstrengend sein.
Wer kennt sie nicht, die Ohne-Punkt-und-Komma-Plappermäuler, die stundenlang und mit wachsender Begeisterung aufzählen, was sie so alles machen, können, haben, wissen, dürfen oder wollen? Wenn die plötzlich und unerwartet fertig sind mit ihrer Litanei, dann schließen sie oftmals mit „und ... ja“. Da sträuben sich mir die Nackenhaare – ich kann's echt nicht mehr hören.
Leser, die sich ein bisschen mit HTML auskennen, wissen, was eine sogenannte "unsorted list" (<ul>), ist. Das ist eine unsortierte Liste, bei der jeder Listeneintrag ("list item", <li>) automatisch mit einem Punkt ("bullet", "·") eingeleitet wird. Die unsortierte Liste hat den Vorteil, dass man nicht von vorneherein wissen muss, wie viele Einträge in diese Liste gehören. Sie hat auch keine Hierarchie. Man kann also einfach mal so ins Blaue hinein aufzählen und aufzählen und aufzählen und ... ja.
| Beispiel einer unsortierten Liste (HTML) | ||
| Code | Bemerkung | Ergebnis |
| <ul> | Beginn der unsortierten Liste |
|
| <li>putzen</li> | erster Listenpunkt | |
| <li>waschen</li> | zweiter Listenpunkt | |
| <li>einkaufen</li> | dritter Listenpunkt | |
| <li>... ja</li> | wirklich ein Listenpunkt? | |
| </ul> | Ende der unsortierten Liste | |
Mir kommt es häufig so vor, als seien solche Und-ja-Zeitgenossen selbst ziemlich unsortiert. Einfach mal drauf los plaudern, bis man nichts mehr zu sagen hat, so ihre Devise. Sollte es nicht möglich sein, das letzte »und« einfach wegzulassen, wenn sowieso nichts mehr folgt? Mich als Zuhörer irritiert das kolossal. Ich lege mir beim Sinn-Erfassen ja schließlich selber vor meinem geistigen Auge eine virtuelle Liste an, die ich dann in den Kontext des Gesagten einbette. Wenn also im letzten Listeneintrag nur »ja« steht, dann muss ich die ganze bisher erstellte Liste im Kopf erneut durchgehen („parsen“) und den letzten Eintrag löschen. Auch wenn das automatisch, unterschwellig und blitzschnell abläuft, finde ich es lästig.
Meistens soll diese fast schon manische Aufzählerei die Quasselstrippe wohl davor schützen, dass ihr jemand ins Wort fällt: „Quatsch mir nicht dazwischen. Du merkst doch, dass ich noch nicht fertig bin. Ein bisschen mehr Rücksicht darf man ja wohl erwarten.“ (der Soziolinguist nennt das Rederecht). Das alles steckt in diesem kleinen Wörtchen »und«. Und weiter geht der Sermon – Augen zu und durch. Wenn dem Schwätzer dann aber nach dem letzten »und« plötzlich nichts mehr einfällt, dann kommt ein linkisches, fast schon hilfloses, auf jeden Fall jedoch völlig sinnloses »... ja«. Im Klartext: „OK, du darfst jetzt auch was sagen (aber mach's kurz).“
Liebe Dampfplauderer und Endloserzähler: Wenn ihr das nächste Mal etwas aufzählt, überlegt euch doch vorher, was alles auf die Liste soll und fangt dann erst an zu reden und bildet dann bitte einen ganzen, abgeschlossenen Satz und lasst dieses blöde »ja« am Ende weg und ... ja, das wollte ich eigentlich nur mal los werden.
Smart?
Ist Ihr Home „clever, gewitzt“, „von modischer und auffallend erlesener Eleganz“, oder sogar „fein“? Dann haben Sie sicherlich ein Smart Home.
So definiert unser aller Duden nämlich das Wort smart. Was, so möchte ich fragen, ist zum Beispiel an einem Smart Phone im Format einer ausgewachsenen Tafel Goldnuss-Schokolade von erlesener Eleganz, geschweige denn clever? Dieser ganze Smart-Hype geht mir im Moment einfach tierisch auf die Nerven. Alles ist auf einmal smart. Mein Haus, mein Kühlschrank, mein Fernseher, mein Telefon, meine Uhr, sogar meine Kleidung. Allesamt clever und gewitzt, oder was? Da möchte ich aber heftigst widersprechen.
Was ist an einem Kühlschrank smart, der sich ständig ohne mein Zutun im Internet herumtreibt und Lebensmittel für mich bestellt? Muss der das? Kann er das nicht einfach mir überlassen? Vielleicht habe ich momentan gar keine Lust auf das Zeugs, das er mir bestellt. Und wer räumt dann den ganzen Plunder in den Smart-Fridge, wenn ich bei Anlieferung nicht zu Hause bin?
Was ist an einem Home, vulgo Haus, smart, das den ganzen Tag im Internet auf Befehle lauert, um die Heizung einzustellen, die Rollläden zu betätigen, das Licht ein- und auszuschalten? Gewitzte Hacker sind heute in der Lage, mein cleveres Haus sozusagen auszulesen und wissen dann genau, dass die Heizung auf Minimum steht, die Lichter über einen Zufallsgenerator geschaltet und die Rollläden über einen Timer gesteuert werden. Mit anderen Worten: Ich bin unterwegs auf Urlaubsreisen. Herzlich willkommen in meinem Smart Home!
Und mein Smart Phone teilt aller Welt ständig mit, wo ich mich gerade aufhalte, ob und wann ich gerade unterwegs bin und wenn ja wohin. Es hält mich den ganzen Tag von der Arbeit ab, macht mein Familienleben zunichte, gaukelt mir Freundschaften vor und schreibt mir in Zusammenarbeit mit meiner Smart Watch auch noch vor, wann und was ich zu essen habe, wann und wie lange ich schlafen soll – und: Sport, Sport und nochmal Sport. Die passenden Smart Clothes senden derweil Informationen über Herzfrequenz, verbrannte Kalorien, Atemfrequenz und wer weiß was sonst noch an mein Smart Phone. Potzblitz!
Da sich diese Gerätschaften allesamt im Netz tummeln, kosten sie natürlich auch noch Gebühren. Ständig. Und wer im Einzelnen was mit meinen Daten in der Smart Cloud tut, das weiß auch niemand so genau. Vermutlich gibt es aber mehr interessierte Parteien, als mir recht sein kann. Wer weiß, ob meine Krankenversicherung nicht schon einen direkten Draht zu meiner Smart Watch hat (Stichwort: Beitragsanpassung), oder meine Banking-App heimlich mit dem Finanzamt unter einer Decke steckt?
Die smarten unter meinen Lesern werden es bereits vermutet haben: Ich besitze gar keines der oben genannten Gadgets. Aber wenn ich mich so umschaue, dann stelle ich immer häufiger fest, dass ich mit dieser Einstellung einer Minderheit angehöre. Viele können sich heutzutage ein Leben ohne ihr Smart-Gedöns gar nicht mehr vorstellen. Ich finde das beängstigend.
„Schöne neue Welt“, kann ich da nur sagen. Für ein bisschen Bequemlichkeit begeben wir uns freiwillig und sehenden Auges jener Rechte und Freiheiten, um die uns viele andere unterdrückte, bespitzelte und überwachte Zeitgenossen glühend beneiden. Wir machen uns zu gläsernen Bürgern, die von Staat und Industrie an der kurzen Leine geführt werden. Und wenn wir nicht spuren: Ein leichter Ruck genügt, und schon gehen wir wieder brav bei Fuß. Ist das etwa smart?
Sagt mal, BBC TopGear Deutschland ...
... bei euch ist aber garantiert mehr als nur ein Rad locker, oder?
Ich habe mir gerade mal rein interessehalber euer neues Heft September-Oktober 2017 gekauft. Und was mir da zum Preis von € 5,90 für ein unglaublicher Quatsch zugemutet wird, das ist mir bisher noch nicht untergekommen. Dieser stets bemüht locker-jugendliche Ton, der sich durch sämtliche ... na, sagen wir mal ... „Reportagen“ zieht und dazu auch noch das ständige Duzen des Lesers, das alles geht mir gehörig gegen den Strich. Die Leute, die für euch schreiben, können einem wirklich den letzten Nerv rauben. Kleine Kostprobe gefällig? Zum Jaguar XE 2018 gelangen dem Schreiberling S. Wagner z.B. folgende Gemmen der Gegenwartsprosa:
„Ein an sich ruhiger, wenig turbolochiger Zeitgenosse, der nur beim Ausdrehen unangenehm vierzylindert.“ „Er macht tatsächlich sowas wie Laune, allradet (Serie) grippig, aber leichtfüßig.“
„Die Extra-Power und der etwas vollere Sound komplementieren ein Chassis, an das noch immer keiner der Rivalen heranreicht. Der Jag teilt sich wunderbar mit, ist Hecktriebler mit Leib und Seele.“
Der Jag vierzylindert also wenig turbolochig, und er allradet grippig? Kann es sein, dass der Autor S. Wagner morgens vergessen hat, seine Medikamente einzunehmen? Und jetzt hat er zu viel Extra-Power, die sein mangelhaftes und wirres Deutsch komplementiert? Ich möchte es, in Anlehnung an seine eigenen Worte, mal so ausdrücken: „S. Wagner teilt sich wunderlich mit, ist Phrasendrescher mit Leib und Seele.“
Hier noch ein weiteres Kleinod, das S. Wagner zum Seat Leon Cupracer aus der virtuellen Feder floss:
„Reichlich unbeeindruckt von meiner heldenhaften Rettungsaktion schüttelt sich der Leon kurz durch und zimmert seine Vorderachse am nächsten Scheitel fest, als hinge er an einem gespannten Bungee-Seil mit mächtig Heimweh.“
Da kann ich nur, Wilfried Schmickler zitierend, dazwischenrufen: „Aufhören! Hör'n Se auf, Herr Wagner ...“. Es ist wirklich unglaublich, unfassbar, unerträglich, was der Mann sich zusammen schreibt. Dazu S. Wagner: „Ich vernehme ein sehr lautes innerliches »Waaaaah«“. Das glaube ich sofort und ohne weiteres.

Leere Versprechungen auf dem Titelblatt
Davon abgesehen ist schon der Aufmacher auf der Titelseite eine Frechheit: „Der GTI ist zurück. Neuer VW Up GTI trifft auf Bugatti Chiron, [...]“. Wenn ich mir dann anschließend den Artikel durchlese: Da wird in einer Tour nur der neue Up GTI über den grünen Klee gelobt. Der Chiron steht nur auf ein paar Fotos als Statist daneben und wird mit kaum einem Wort erwähnt. Der namentlich ungenannte Redakteur (S. Wagner?) hat wohl keine Genehmigung bekommen, sich dem heiligen Gral des Automobilbaus auf weniger als zehn Meter zu nähern – kann ich auch irgendwie nachvollziehen, bei der brisanten Paarung „leicht überforderter Tastaturquäler trifft auf Zweieinhalb-Millionen-Euro-Super-Sportwagen“. Aber dann weckt doch auch bitte nicht großmäulig auf dem Titelblatt Hoffnungen auf einen Vergleichstest oder ähnliches, dem dann im Heftinneren nur ein wenig inspirierter, eher fader Fahrbericht über lediglich eines der angekündigten Fahrzeuge folgt, mit dem niemand – wirklich niemand – auf »große Fahrt« (GTI = Gran Turismo Injection) gehen möchte.
Wenn das der Neue Deutsche Motorjournalismus ist, dann verzichte ich gerne und greife zur Springer-Presse. Die ist mir zwar politisch eher suspekt, dafür beschäftigt sie aber richtige Journalisten, die ihr Metier beherrschen. Bei denen ist zwar auch ständig alles „irre“, aber sie können ganze Reportagen schreiben, ohne einen einzigen selbstgeschnitzten Neologismus zu verwenden. Interessant statt nervig, informativ statt einseitig: so geht das.
Sorry, TopGear, aber der frische Wind, der wohl offensichtlich durch euer Blättchen wehen soll, riecht verdächtig streng nach flatus cerebri.
Nachtrag im März 2018: Auch die bisher als seriös geltende Fachzeitschrift auto motor und sport* beschäftigt mittlerweile einen ähnlich kreativen Sprachverunstalter wie TopGear: Sebastian Renz. In einem SUV-Vergleichstest in Heft 6/2018 erfand er unter anderem die Raumwunderei, einen nicht so zusammencontrollerten Audi, eine sich eilig verdoppelkuppelnde S tronic, einen sich der nächsten Geraden entgegengrippenden Q3, einen quermotorigen und vorderradantriebigen X1, eine knobelige Bedienung, Sitze mit Sinn ergebender Seitenhaltintensität, katapultige Stöße, ein wandleriges Doppelkupplungsgetriebe, alltagsclevere Funktionen, eine herausforderungsreiche Bedienung und einen BMW, der sich hinterradagil und lastwechselmotiviert fährt. Hut ab vor so viel Einfallsreichtum! Davon kann sich S. Wagner aber noch ein bis zwei dicke Scheiben abschneiden.
* Eigenbeschreibung: „Die Auto-Zeitschriften der Motor Presse Stuttgart stehen weltweit für fachliche Kompetenz und journalistische Qualität.“
Reflexive Radikalisierung
Wie man hört, radikalisieren sich in letzter Zeit immer mehr muslimische Männer und Frauen. Wie machen die das eigentlich?
Radikal: eine extreme politische, ideologische, weltanschauliche Richtung vertretend [und gegen die bestehende Ordnung ankämpfend], Adjektiv. So weit die Definition des Dudens. Radikalisieren ist ein von diesem Adjektiv abgeleitetes Verb. Es bedeutet gemäß den Wortbildungsregeln radikal machen.
Was hat es nun aber mit dem reflexiven Verb sich radikalisieren auf sich? Kann sich jemand selbst radikalisieren, d.h. auf sich selbst dergestalt einwirken, dass er radikal wird? Ergibt das irgendeinen Sinn? Nehmen wir an, ich sei ein friedliebender Mensch, der viel Zeit hat. Wie stelle ich es an, dass ich mich radikalisiere? Radikales lag mir ja bisher eher fern. Ich führe also intensive Selbstgespräche und werde von Tag zu Tag radikaler in meinen Ansichten, die sich aus dieser inneren Diskussion ergeben. Ja, klar.
Der normale Weg wird wohl eher sein, dass irgendein Dritter auf mich einwirkt, auf mich einplaudert, mich zuquatscht, mir wirres Gedankengut einpflanzt und mich auf diese Weise allmählich auf sein radikal schwarz-weißes Weltbild einschwört. Das würde ich als radikalisieren bezeichnen. Ich habe aber dazu keinen Beitrag geleistet. Der andere hat geredet, ich habe geglaubt. Nicht ich habe, sondern er hat mich radikalisiert.
Sich radikalisieren – woher kommt nur dieser Ausdruck und wer hat ihn erfunden? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er im Grunde genommen ziemlich rassistisch ist: Erweckt er doch den Eindruck, dass jeder Muslime in sich die Saat des Bösen trägt, die nur zum Keimen gebracht werden muss. Und wenn niemand darauf regnen möchte, dann tut's der Muselmann eben selbst. Kein Problem! Eben noch war er ein netter Ehemann, Familienvater, Nachbar, Kollege und auf einmal – zack – beschließt er, den offenbar genetisch vorbestimmten Pfad einzuschlagen und sich zu radikalisieren. Kein Imam, kein Mullah, kein Prediger ist dazu nötig; das geht wie von selbst. Ja, klar.
Wie ich das sehe, gehören zum Radikalisieren stets mindestens zwei, gerne auch mehr Leute. Die eine Seite redet, die andere glaubt. Und wer leichter glaubt wird schwerer klug. So einfach ist das. Der ganze begriffliche Eiertanz um die Radikalisierung ist doch nur der Zwickmühle geschuldet, die unsere verfassungsmäßig verbriefte Religionsfreiheit in sich birgt: Es ist uns nicht erlaubt zu sagen, dass es islamische Geistliche und deren fanatische Anhänger und Mitläufer sind, die friedliche Muslime radikalisieren und für ihre Ziele instrumentalisieren. Und wir dürfen sie auch nicht des Landes verweisen. Denn Religion ist tabu.
Also ward die Mär von der Selbstradikalisierung geboren und schon muss sich niemand mehr mit einem Problem herumschlagen, bei dem die Fettnäpfchendichte dermaßen hoch ist, dass stets ein diplomatisch-religiöser Eklat droht. Ja, und damit haben wir auch schon eine Antwort auf die Frage, wer das Sich-Radikalisieren vermutlich erfunden hat: Das können eigentlich nur Politiker gewesen sein.
Kraftanstrengung und Energieleistung
Sie gehören zum Wortschatz eines jeden guten Sportjournalisten. Aber wieviel Sinn verbirgt sich hinter diesen Fachbegriffen?
Wer kennt sie nicht, diese Sprüche unserer hochbezahlten Fernseh-Sport-Kommentatoren? Anstrengung und Leistung genügen heutzutage einfach nicht mehr. Man muss das doch noch irgendwie steigern können. Am besten mit besonders dynamisch klingenden Zusätzen, wie Kraft, Energie, Super, Mega, Hyper ...
Betrachten wir doch einmal diese Begriffe etwas genauer: Was genau könnte eine Kraftanstrengung, was eine Energieleistung sein? Rein naturwissenschaftlich betrachtet gibt es die Begriffe Kraft, Energie und Leistung. Die Anstrengung ist leider nicht dabei. Aus Sicht eines Physikers kann man also die Kraftanstrengung schon mal als sprachliche Missbildung ohne jeden akademischen Wert abtun. Nicht jedoch die Energieleistung.
Was zeigt uns das?
- Leistung bleibt Leistung – egal, wie viel Energie man hineinsteckt.
- Die Energieleistung ist Quatsch mit Soße – die Kraftanstrengung sowieso.
- Schwarzbrot ist gut für Sportler – aber in Maßen.
- Sportjournalisten leben in ihrem eigenen Universum.
Konsonantencluster
Vielleicht haben Sie es noch nicht bemerkt: Die deutsche Zunge schafft es mühelos, bis zu sieben Konsonanten nacheinander zu sprechen.
Endet nun der erste Wortteil mit einem Konsonantencluster und beginnt der zweite Wortteil mit einem ebensolchen, dann entstehen Gebilde, die für die fremdländische Zunge schier unaussprechlich sind. Zu einiger Berühmtheit hat es der Angstschweiß gebracht, in dem immerhin acht Konsonanten aneinander gereiht zu sein scheinen. Genau betrachtet sind es deren nur fünf: Das Wort spricht sich [aŋstʃvaɪs]*. Auch die Weihnachtsstimmung hat in Wirklichkeit nur fünf Konsonanten am Stück: [vaɪnaxtsʃtɪmuŋ].
Es geht mir an dieser Stelle nämlich nicht um Konsonantenbuchstaben, sondern nur um tatsächlich gesprochene Laute. Das sch besteht zum Beispiel aus drei Konsonantenbuchstaben, aber nur aus dem Laut [ʃ]. Auch ng [ŋ] und ch [ç] bzw. [x] gehören zu dieser Sorte. Auf der anderen Seite haben wir x [ks] und z [ts], die jeweils zwei gesprochene Konsonanten enthalten. (Ypsilon und Jot klammern wir hier der Einfachheit halber aus.)
Natürlich kann man beliebige sechsstellige Konsonantencluster konstruieren – z.B. den Pabstsprung – aber in den wenigsten Fällen ergeben sie wirklich Sinn. Ich habe hier einmal eine Liste zusammengestellt, die sinnvolle Exemplare aufzählt. Ich werde sie nach Möglichkeit ständig erweitern. Gerne nehme ich auch weitere Vorschläge unter der auf der Startseite angegebenen E-Mail-Adresse entgegen.
| Liste einigermaßen sinnvoller Wörter mit 6 oder mehr nacheinander gesprochenen Konsonanten | ||
|---|---|---|
| Kunstsprache [nstʃpr]* | Grenzstreitigkeiten [ntsʃtr] | Textstruktur [kstʃtr] |
| Sumpfpflanze [mpfpfl] | Durststrecke [rstʃtr] | Kurzstrecke [rtsʃtr] |
| Zukunftspläne [nftspl] | Schifffahrtsstraße [rtsʃtr] | Herzstromkurve [rtsʃtr] |
| Kampfstrategie [mpfʃtr] | Arztsprechstunde [rtstʃpr] 7! | Dienstpflicht [nstpfl] |
| Sicherungssplint [ŋksʃpl] | Holzpflege [ltspfl] | Salzstreuer [ltsʃtr] |
| Ankunftszeit [nftsts] | Unterhaltspflicht [ltspfl] | selbstspreizender Dübel [lpstʃpr] 7! |
| Herbstzeitlose [rpst'ts] | (wird fortgesetzt) | |
Im Tschechischen habe ich dann auch den bisherigen Sieger gefunden: čtvrthrst [tʃtvrthrst]*, eine viertel Handvoll – erinnert zwar stark an den oben erwähnten, ebenfalls ziemlich sinnfreien Pabstsprung, hat aber sage und schreibe zehn Konsonanten ohne einen einzigen störenden Vokal. Und sogar bei sinnvollen Wörtern wird man fündig: čtvrtka [tʃtvrtka]. Man bezeichnet damit ein Viertel, und hier sind es immerhin auch noch sieben Mitlaute in einer Reihe.
Ein Hoch auf die Feinmotorik des Zungenmuskels! Sind Sprachen nicht etwas Schönes?
*innerhalb der eckigen Klammern befindet sich die IPA-Notation (Internationales Phonetisches Alphabet)
Mir scheint,...
... dass viele den Unterschied zwischen anscheinend und scheinbar nicht kennen.
Anscheinend bedeutet, dass es deutlich so aussieht, als lägen Fakten vor. Wenn ich sage: „Anscheinend hat dein Auto eine Beule“, dann meine ich, dass es für mich so aussieht, als habe dein Auto eine Beule. Ich habe den Eindruck, es kommt mir so vor, allem Anschein nach – anscheinend – ist es so.
Scheinbar ist aber etwas ganz anderes. Etwas gibt sich dann lediglich den Anschein, ist aber in Wirklichkeit ganz anders. Wenn ich sage: „Dein Auto hat scheinbar eine Beule“, dann weiß ich genau, dass es keine Beule hat – es sieht eben nur so aus, es scheint nur so, es macht fälschlicherweise den Eindruck, als sei es so.
Das kann im Ernstfall von immenser Bedeutung sein.
Wenn ich sage: „Anscheinend betrügt dich deine Frau“, dann äußere ich den Verdacht, dass deine Frau fremdgeht. Nach allem, was ich gesehen und gehört habe, nach Lage der Dinge, scheint es so zu sein, die Beweislast ist erdrückend. Such dir was Neues.
Sage ich aber: „Scheinbar betrügt dich deine Frau“, dann teile ich dir mit, dass mich und/oder dich der Schein trügt und dass sie dir in Wirklichkeit vermutlich treu ergeben ist. Der Anschein hat sich nicht bestätigt. Man würde den Satz vermutlich deutlicher formulieren: „Deine Frau betrügt dich nur scheinbar". Sie tut nur so (warum auch immer). Alles wird gut.
So betrachtet ist es die Sache doch wert, erst einmal das richtige Wort zu wählen und dann erst über Schein oder Anschein zu sprechen. Zumindest bewahrt es alle Beteiligten vor Missverständnissen.
Wir sind das Volk!
Diese Parole, die einst Deutschland geeint hat, wird neuerdings vom rechten Pöbel skandiert. Dazu sage ich deutlich: Nein, seid ihr nicht!
Das Volk – das sind die anderen, die für Freiheit und Gleichberechtigung aller Menschen eintreten, und nicht für ihr eigenes engstirniges Weltbild, in dem alles Fremde angezündet oder zurückgeschickt gehört, in dem ein Leben nichts gilt und die Volkszugehörigkeit alles, in dem ein Araber oder einfach jeder Muslim von vorneherein unter Generalverdacht steht.
Was habt ihr eigentlich gegen Syrer, die durch Kriegselend und Verfolgung dazu genötigt wurden, ihre Heimat zu verlassen? Glaubt ihr wirklich, die kommen nur hierher, um ein bisschen Taschengeld abzugreifen und unsere Frauen und Töchter zu schwängern? Diejenigen, die sich die beschwerliche und lebensgefährliche Anreise leisten konnten und dabei oftmals engste Familienangehörige verloren, sie gehörten früher zur Mittelschicht ihres Landes, und sie hatten in ihrer Heimat ein gutes Leben und viele Kollegen, Freunde und Verwandte, die sie zurücklassen mussten – und eine jahrhundertealte Kultur. Das tut niemand freiwillig. Aber täglicher Bombenhagel kann das bewirken.
Und hier empfangt ihr sie mit geballten Fäusten und Molotowcocktails, mit brennenden Fackeln und Scheißhausparolen. Ihr seid wirklich das Salz der Erde, das Licht der Welt, barmherzige Christen!
Natürlich gibt es in jedem Fass ein paar faule Äpfel (solche wie ihr), aber das bedeutet doch nicht, dass diese Flüchtlinge allesamt unwert sind, grundsätzlich schlecht, parasitär und in unsere Gesellschaft nicht zu integrieren. Bedenkt, dass auch eure Vorfahren vor langer Zeit einmal in dieses Land eingewandert sind. Letztenendes stammen wir doch alle aus Afrika – ja, auch ihr. Informiert euch gefälligst!
Nix für ungut, aber wenn ihr das Volk seid, dann möchte ich nicht dazugehören. Mein Volk hat aus den zahlreichen Fehlern der Vergangenheit gelernt, ist geläutert, weltoffen und gastfreundlich.
Ich kann nur wiederholen: Ich bin nicht Charlie Hebdo, ich bin kein Christ, kein Jude, kein Muslim: Ich bin ein Mensch. Und auch diese Flüchtlinge sind in erster Linie genau das: Menschen. Behandelt sie menschlich.
Textur?
Neuerdings haben sogar Kosmetika und Gourmetprodukte eine. Was ist das eigentlich: Textur?
Was also ist die Textur beim Essen? Die Oberflächenstruktur der Speisenbestandteile? Das Krümelige der Krume, das Bröckelige des Brokkolis, das Pampige des Pürees? Mitnichten. „Textur, Textur, ich sage nur: Textur!“ rief ein ob eines besonders gelungenen Probierlöffels enthusiasmierter Sternekoch beschwörend in die beifallnickende Runde. Es muss also etwas Außergewöhnliches, Erstrebenswertes, eventuell sogar leicht Esoterisches, schwer Fassbares sein.
Vielleicht kommen wir mit der Weinkunde weiter. Hier wird mit Textur das Mundgefühl (gerne auch Mouth Feeling) bezeichnet und umfasst alles, was man normalerweise nicht mit Worten ausdrücken kann: Geschmack – oder sensorische Wahrnehmung, um es bedeutender klingen zu lassen. Die Textur eines Weines kann sowohl
„samtig, voll, seidig, dicht, wuchtig, fleischig, cremig, fett, schmelzig oder tiefgründig, als auch leicht, trocken, knackig, vornehm, harmonisch oder duftig sein“. (Wikipedia)
Und
„wenn die Worte ausgehen oder die Fantasie fehlt, hört man auch von einer herrlichen, grandiosen, runden, aromatischen oder einfach schönen Textur“. (ebd.)
Die Analogie zu anderen Gaumenfreuden ist naheliegend und nachvollziehbar. Wenn also der sternenbehängte Obermützenträger Textur will, dann meint er vermutlich Geschmack und Mundgefühl, ein sahniges Zerlaufen von Saucen, eine prickelnde Espuma, feinschmelzende Schokolade. Aber warum erklärt uns Normalverbrauchern das niemand? Woher soll unsereiner das Fachvokabular kennen? Oder ... hat sich das nur einer von diesen Löffelschwingern ad hoc ausgedacht und alle anderen Mützenträger plappern es jetzt nach? „Textur? Superwort! Muss ich mir merken. Klingt geheimnisvoll.“ Möglicherweise eine heiße Spur.
Und jetzt taucht in der Werbung für Kosmetikprodukte ebenfalls auf einmal dieses Zauberwort auf. Und wieder weiß keiner, was gemeint ist. Der Geschmack wird's ja wohl nicht sein, geschweige denn das Mundgefühl ... Schauen wir mal, was die Fachwelt zu sagen hat:
„Trage- und Applikationskomfort von Kosmetik-Produkten hängen sehr stark von der Textur ab. Ob cremig weich oder präzise, kräftig deckend oder natürlich transparent - die wesentlichen Eigenschaften von Kosmetikstiften werden durch deren Texturen bestimmt“. (schwancosmetics)
Das definiert zwar immer noch nicht, was Textur eigentlich ist, aber ... so eine nebulöse Vorstellung bekommt man schon davon. Mehr ist vielleicht auch gar nicht beabsichtigt in dieser Welt der Andeutungen und Versprechungen, der Schönheit und der ewigen Jugend. Applikationskomfort, Produkte, Cremigkeit, Präzision, Transparenz, Textur - das Vokabular eines entfernten Paralleluniversums.
Zum Abschluss möchte ich noch weitere Texturen kurz streifen, die auch wieder aus Wikipedia entliehen sind:
- ein „musikalisches Muster durch Aneinanderreihen von Variationen eines Motivs“
- die „räumliche Anordnung eines bestimmten Gesteingemenges“
- die „Gesamtheit der Orientierungen der Kristallite in einem vielkristallinen Festkörper“
- das „polarisationsmikroskopische Erscheinungsbild einer Mesophase von Flüssigkristallen, vorzugsweise zwischen gekreuzten Polarisatoren“
- der „internationale Begriff für die Zusammensetzung des Feinbodens nach der Korngrößenverteilung“.
Welch ein vielseitiges Wort! Die ganze Welt besteht aus Texturen. Ist das nicht toll? Ich muss jetzt wieder in die Küche: die Textur meiner Tomatensauce muss noch verbessert werden. Apropos Nudeln – auch matschig ist eine Textur. Mahlzeit!
Liebe Terrorismusexperten, ...
... liebe Sensationsjournalisten, anlässlich der Morde am 13. November 2015 in Paris: Haltet doch, bitte, einfach mal die redensartliche* Fresse!
Es wird sich nichts bessern dadurch, dass 10.000 Zeugen immer wieder schildern, wie schrecklich das alles war. Wir können es uns auch so vorstellen. Wir müssen das nicht 24/7 um die Ohren geschlagen bekommen. Wir haben es auch beim ersten Mal verstanden.
Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass ihr genau denen dient, denen euer ganzer Abscheu gilt? Dass gerade das Verbreiten eurer sogenannten Informationen genau den Zielen dient, die die Gegner unserer Kultur, unserer Staatsform, unseres Lebensstils, unseres Glaubens verfolgen? Da wird analysiert, kommentiert, gemeint, gemutmaßt, orakelt, und alle tanzen sie um das Goldene Kalb: die Quote.
In Wahrheit schürt ihr damit Hass – und berichtet dann wieder von brennenden Asylen, en détail, in High Definition und zur besten Sendezeit. Auch ihr schafft ein Klima von Angst und Schrecken, auch das ist eine Form von Terrorismus. Das hat nichts mehr mit Pressefreiheit zu tun.
Und damit meine ich nicht nur die Vertreter unserer privaten Fernsehsender samt ihren Nachrichtenkanälen. Auch die Öffentlich-Rechtlichen von Funk und Fernsehen scheinen der Ansicht zu sein, sie müssten uns mit allen Einzelheiten versorgen, koste es, was es wolle, zu jeder Zeit, an jedem Ort und ohne jeden Respekt. Alle suhlen sich behaglich in schauerlichen Fakten, plastischen Schilderungen, verwackelten Handy-Videos, Vor-Ort-Reportagen und tränenreichen Zeugenaussagen. Wozu?
Ich will das nicht. Gebt dem Terror keine Plattform! Berichtet objektiv und in angemessener Kürze über die Fakten und werft Spekulationen, Kommentare und Hintergrundberichte auf den Müll. Berichtet erst dann über Ergebnisse, wenn sie vorliegen. Das wäre für mich engagierter Journalismus. Das brächte den Tätern und deren Anstiftern die Aufmerksamkeit entgegen, die sie verdienen: Keine.
Ich bin nicht Charlie Hebdo, ich bin kein Christ, kein Jude, kein Muslim: Ich bin ein Mensch. Die Opfer des 13. November waren Menschen. Ihre Hinterbliebenen sind Menschen. Gebt ihnen, was sie am meisten brauchen: Ruhe und Würde.
*„ Wenn man keine Ahnung hat: einfach mal Fresse halten.“ (Dieter Nuhr)
Schein-Englisch
bis heute*
Den Bodybag umgeschnallt, rein in den Oldtimer und ab zum Public Viewing. Aber vorher noch zum Drive-in, man will ja nicht vor lauter Hunger das Happy End verpassen.
Grundsätzlich kann man zwei Sorten von Scheinanglizismen unterscheiden: Solche, die es tatsächlich in der englischen Sprache gibt, dort aber etwas anderes bedeuten; und solche, die dort gar nicht bekannt sind. Stets scheint aber, wie ich meine, bei deren Entstehung eine gewisses Quäntchen an Ignoranz im Spiel gewesen zu sein. Ich will jetzt gar nicht mit dem Handy anfangen. Dieses Thema wurde bereits andernorts eingehend behandelt. Aber es ist eben bei Weitem nicht der einzige bilinguale Irrläufer, der zu beklagen ist.
Starten wir also zunächst mit der ersten Sorte, den Wörtern, die im Englischen eine andere Bedeutung haben:
- Der Bodybag: Im Deutschen die Bezeichnung
für eine Art Umhängetasche, im Englischen ein Leichensack.
Die vorgenannte Tasche heißt übrigens richtig messenger bag.
- Das Public Viewing: Wird in Deutschland gerne auch Rudelglotzen
genannt und regelmäßig bei Fußballgroßereignissen
veranstaltet, kennt der des Englischen Mächtige als öffentliche
Aufbahrung eines Leichnams.
Der richtige Ausdruck wäre public screening. Wer also mit
dem Bodybag zum Public Viewing geht, liegt gar nicht mal so daneben
...
- Der Oldtimer: Im Deutschen ein über dreißig
Jahre altes Auto, im Englischen ein alter Mann. Der
korrekte Ausdruck ist vintage car oder classic car.
Genau so sollten solche Fahrzeuge auch im Deutschen heißen:
Klassische Automobile (und bitte auch nicht Schnauferl).
- Der oder das Drive-in: Im Deutschen ein Geschäft
mit Autoschalter, das der Amerikaner viel richtiger
als drive-thru, bezeichnet, weil man ja hindurch (through)
fährt und nicht hinein (in). Ein Drive-in ist ein Autokino – da fährt
man ja auch tatsächlich hinein.
- Der Smoking: Als Abendanzug mit
seidenen Revers kennt ihn der Deutsche. Auf englisch heißt smoking
schlicht Rauchen (no smoking = Rauchen verboten). Der Ami sagt tuxedo
zu seinem Smoking, während der Engländer vom dinner jacket
oder dinner suit spricht.
- Der Streetworker: Sozialarbeiter, der in
sozialen Brennpunkten auf
der Straße arbeitet. Der Engländer nennt seine Straßenprostituierten
streetworker (to work the streets = auf den Strich gehen). Was wir meinen heißt social
(street) worker
– vive la différence!
- Das Speedboot: Die Formel 1 unter den Motorbooten.
Aber nur bei uns. Im englischsprachigen Raum zieht man mit speedboats
Wasserskifahrer oder dreht mal eine flotte Runde über den See. Aber
die mit bis zu 260km/h richtig schnellen Rennmaschinen heißen
dort power boat.
- Der Beamer: So bezeichnet man hierzulande
einen Videoprojektor, der folgerichtig auf englisch video
projector oder digital projector heißt. Beamer
oder Beemer sagt
der Nordamerikaner zu seinem BMW, um sich das umständliche
Bie-Emm-Dabbeljuh zu ersparen. Der Brite hingegen kennt den Beamer
(auch beam ball) als einen unerlaubten Wurf im Cricket.
- Das No-Go: Ein Verbot oder Tabu. Die auch schon
ziemlich bescheuerte Formulierung „Das geht gar
nicht“ wurde mal eben flugs verdenglischt zu „das ist ein
absolutes No-Go“. Der Amerikaner nennt so etwas ein no-no.
„This is no-go“ heißt hingegen „Das funktioniert
nicht“, wobei no-go ein Adjektiv ist. Es entstammt dem
Astronautenjargon, wo es unter anderem die beiden Begriffe go
(intakt) und no-go (kaputt) gibt.
- Der Slip: Eine meist knapp geschnittene Unterhose
– wahrscheinlich aus dem Schlüpfer (to slip = schlüpfen)
entstanden. Im Englischen bezeichnet slip
ein Unterkleid, während unser Slip dort als briefs bekannt
ist.
- Der Overall: Arbeitsanzug, den man über
die normale Bekleidung zieht, auf englisch aber ein Arbeitsmantel.
Der richtige Begriff ist overalls, coverall oder jump
suit.
- Das Shooting: Ist bei uns ein Fototermin,
bei dem meistens Mode-Aufnahmen gemacht werden. Auf englisch heißt das photo
shoot. Shooting ist in englischsprachigen Ländern eine Schießerei!
- Der Body: Ein einteiliges Kleidungsstück,
überwiegend von Frauen getragen, sieht man auch schon mal beim Shooting.
Der Brite/Amerikaner sagt dazu body suit. Body heißt einfach Körper,
oder auch Leiche – das passt dann wieder zum Shooting...
- Der Evergreen: Bei uns ein Hit aus vergangenen
Tagen, den auch heute noch jeder kennt. Im Englischen ist evergreen
– zumindest in den meisten Fällen – eine Konifere (ein
Nadelbaum). Wer beim DJ jedoch Golden Oldies bestellt,
der bekommt das Gewünschte.
- Der Backshop: Bei uns ein Großverramscher von
Billigst-Backwaren der
untersten Qualitätskategorie.
Ein des Englischen mächtiger
Kunde wird sich hingegen verwundert
die Augen reiben: Mit backshop
bezeichnen
anglophone Schwule den dark
room, wenn er (noch) beleuchtet
ist. Auch eine kleinere Reparaturwerkstatt
kann ein backshop
sein.
- Der Shootingstar: Bezeichnet jemanden, der die
Karriereleiter besonders schnell empor eilt. Dabei ist ein shooting
star eigentlich eine Sternschnuppe, und die steigt bekanntlich
nicht, sondern fällt und verglüht. Was wir meinen, ist ein rising
star.
- Der Slipper: Ein Schuh ohne Schnürsenkel, in den man
einfach hineinschlüpft. Der englische Ausdruck dazu
ist komplizierter: slip-on shoe. Der englische slipper
ist ein Hausschuh.
- Das Mobbing: Einen Arbeitskollegen ständig
schikanieren, quälen, verletzen.
Das heißt in anglophonen Gegenden
bullying. Das englische
mobbing gibt es nur in der Tierwelt
und heißt auf deutsch »Hassen«:
Durch Hassen machen sich Artgenossen
gegenseitig auf einen anwesenden
Raubfeind und dessen Aufenthaltsort
aufmerksam.
Häufig zu beobachten sind Alarmrufe,
Scheinangriffe, gezieltes Erbrechen und Kotspritzen – genau
wie im richtigen Leben!
- Die Wallbox: Eine an die Wand geschraubte Ladestation für Elektroautomobile. Dem Engländer eher bekannt unter dem Namen wall-connector. Eine wallbox ist ein eingemauerter Briefkasten.
Und nun zur zweiten Sorte, den komplett erfundenen Scheinanglizismen (wer denkt sich bloß so einen Mist aus?):
- Das Happy End: Würde der Engländer als Fehler
einstufen, da es happy ending heißt. War dem Deutschen wahrscheinlich
zu lang und zu kompliziert.
- Der Pullunder: Kurzärmlig wie eine Weste, aber
ohne Knöpfe, meist unter dem Sakko getragen. Bei Hans-Dietrich
Genscher immer gelb. Meist „Polunder“ ausgesprochen, wie Holunder
– keinesfalls jedoch „Pulander“. Heißt auf englisch sweater vest. Ein englisches Wort pullunder
gibt es nicht.
Übrigens ist auch der Pullover nur im deutschen und romanischen
Sprachgebiet bekannt – in England heißt er meistens jumper, in
Amerika sweater.
- Der Discounter: Der Supermarkt mit dem
einfachen Sortiment und den niedrigen Preisen. Kommt von englisch discount
= Rabatt. Das Äquivalent heißt
aber discount store.
- Der Hometrainer: Übungsgerät für den
Hausgebrauch zum Erwerb und zur Bewahrung von Fitness.
Auf englisch spricht man von einem exercise bicycle. Von
einem hometrainer hat der Engländer noch nie gehört.
- Das oder die Basecap: Kappe mit großem Schirm,
zunächst bei Baseballspielern beliebt, später (leider)
bei jedermann. Heißt auf englisch auch völlig korrekt baseballcap,
was aber der deutschen Zunge anscheinend nicht zumutbar ist.
- Der Messie: Jemand, der Sachen anhäuft
und nichts wegwerfen kann. Das Adjektiv messy (unordentlich,
chaotisch) ist in anglophonen Ländern bekannt, der Messie
aber nicht. Dort nennt man ihn compulsive hoarder.
- Der Talkmaster: Leitet bei uns eine Talkshow.
Deshalb heißt er im Englischen auch talk show host oder
auch chat show host. Der Gastgeber einer Talkshow.
Einen – wie auch immer gearteten – talkmaster
(Sprechmeister) gibt es in der englischen Sprache nicht.
- Die Standing Ovations: Wieso gleich mehrere? In
anglophonen Gebieten
reicht eine: standing ovation. Ist dem Deutschen wohl zu wenig.
- Der Dressman: Führt bei uns modische Kleidung vor.
Kennt man in England, USA und Kanada als male model.
- Die Beauty Farm: Der Jungbrunnen für betuchte ältere
Damen und solche, die es werden wollen. Ist native speakers unter dem
Namen spa bekannt.
- Die Castingshow: Show in der man (bestenfalls) Geld,
aber keinen Ruhm ernten kann. Verständlicher
wäre talent show.
- Der Service Point: Ort, an dem man von übelgelaunten
Servicekräften ungenaue Auskünfte bekommt. Heißt außerhalb
Deutschlands information desk.
- Der Twen: Junger Mensch über zwanzig. Gibt's im Englischen
nicht. Wurde von der Werbebranche erfunden. In etwa entsprechend:
person in their twenties.
- Das Peeling: Kosmetisches
Produkt zum Entfernen der oberen Hautschicht. Muttersprachler nennen so
etwas je nach Anwendung face scrub oder body scrub.
- Flips:
Extrudierter Mais-Snack mit Erdnussaroma. Ein flip ist eigentlich
etwas Hochgeworfenes, das sich in der Luft dreht – also beispielsweise
eine Münze oder ein Sportler beim Salto. Für unsere Erdnussflips gibt es
keinen Begriff, höchstens eine Umschreibung: corn puff snack
Schließlich gibt es noch Ausdrücke, die dem Englischen entlehnt sind – aber leider wortwörtlich, und deshalb falsch:
- realisieren: Das englische to realise
bedeutet erkennen, merken, begreifen. In diesem Sinn wird es auch gerne
fälschlich im Deutschen benutzt. Etwas realisieren
bedeutet aber eigentlich, dass man etwas
verwirklicht, etwas in die Tat
umsetzt. Realisieren
und to realise sind falsche Freunde (false friends).
- kontrollieren: Früher hat der Schaffner die
Fahrkarte kontrolliert: Er hat geschaut,
ob sie gültig ist und bei Bedarf mit seiner
Zange gelocht. Diese ursprüngliche Bedeutung
von kontrollieren scheint fast in Vergessenheit
geraten zu sein. Mittlerweile
kontrollieren Armeen Gebiete,
Aufsichtsgremien
kontrollieren Fernsehsender,
der Bundestag kontrolliert
die Bundeswehr. Wenn ich so etwas
höre, stelle ich mir immer den Mann mit der roten Schirmmütze vor:
„Die Fahrkarten, bitte“ ... Natürlich
sind auch hier wieder falsche Freunde schuld:
kontrollieren ≠ to control. Im Deutschen
gibt es leider nur den etwas sperrigen Begriff „die Kontrolle
über etwas oder jemanden haben“, in manchen Fällen
reicht auch beherrschen aus.
- Herzattacke: Die englische heart attack
heißt auf deutsch Myokardinfarkt oder einfach Herzinfarkt.
Zu klären bliebe auch noch, wer hier wen angreift, bzw. attackiert.
- Sinn machen: Falsche Freunde, wohin man auch schaut! Das englische to make bedeutet in den seltensten Fällen machen, genau wie auch sense nicht genau Sinn bedeutet. Deshalb ergibt „Sinn machen“ (to make sense) auch keinen Sinn. Näheres dazu kann man hier finden.
Man sollte sich stets auf dem Laufenden halten. Die ersten paar Monate nach dem ersten Erscheinen darf man solche Scheinanglizismen gerne mal hie und da fallen lassen. Wenn sich's dann aber herumgesprochen hat, das mit dem falschen Schein, dann sollte man schon wieder abgesprungen sein, sonst ist das ein absolutes No-Go.
Dank an Dana Newman (WantedAdventure) und Paul Joyce (Paul Joyce German Course) für einige Ergänzungen. Diese Liste wird ständig weiter vervollständigt.
Pari-pari unentschieden
Für unentschieden gibt es sinnvolle und sinnfreie Umschreibungen.
Der Duden kennt pari stehen, was soviel wie Gleichstand heißt. Er kennt auch remis, das er so definiert: „Im Gleichstand, patt; (Sport) punktgleich, unentschieden“.
Was meinte unser Fernsehfuzzi also wohl mit pari-pari unentschieden? Ist das jetzt noch gleicher als gleich – sozusagen dreimal gleich? Ich vermute, dem Sprecher erschien von irgendwoher ein Fifty-fifty, das er dann, nicht imstande diesen geistigen Furz einzuhalten, blitzschnell der Situation anpasste und par-pari daraus erschuf. Diese Aufdoppelung hatten wir ja schon einmal bei der Mund-zu-Mund-Propaganda, und auch dort traf sie irgendwie nicht so recht den Kern. Und weil der Herr Moderator uns alle für blöde hält und meint, wir wüssten nicht, was pari heißt, hängt er an seine Neuschöpfung gleichsam als erklärende Übersetzung auch noch unentschieden an: Pari-pari unentschieden. Typisches Fernseh-Blabla, das sich wohl früher oder später im Wortschatz seiner Moderatoren- und Journalistenkollegen und leider sicher auch in dem der Zuschauer wiederfinden wird.
Fassen wir zusammen: Pari-pari gibt es nicht. Für unentschieden gibt es jedoch eine riesige Auswahl an Synonymen. Da muss wirklich nichts Neues mehr erfunden werden!
Nachtrag im Dezember 2018: Wie recht ich doch hatte: »pari-pari« (ohne das unentschieden) hat sich tatsächlich unter Fernsehschaffenden verbreitet.
Stundenkilometer?
Der Stundenkilometer ist in aller Munde, denn er zergeht auf der Zunge, er flutscht so schön raus. Kilometer pro Stunde hat nur eine Silbe mehr, aber es fühlt sich sperrig an, die Gaumenauskleidung ist unbefriedigend. Was also spricht gegen das leckere Neuwort?
Zurück zu den Stundenkilometern. Herr, laß Hirne regnen! Das hat mein Physiklehrer immer zu mir gesagt. Natürlich bezeichnet auch dieses Determinativkompositum einen Quotienten: Kilometer in Bezug auf die Stunde, denn das n ist keine Pluralendung, sondern ein Fugenelement. Stundenkilometer sind also Kilometer pro Stunde.
Einigen wir uns zunächst darauf, dass es sich bei dem Begriff Kilometer pro Stunde um eine physikalische Einheit handelt. Es ist die Einheit der Geschwindigkeit, ein Quotient aus Weg und Zeit. Da die Kilometer im Zähler und die Stunden im Nenner stehen, schreibt man gemeinhin km/h, wobei der Schrägstrich das Divisionszeichen des Bruches darstellt und geteilt durch oder pro ausgesprochen wird. Einigen wir uns ferner darauf, dass man das Produkt a·b in der Mathematik auch als ab bezeichnen darf, und dazu dann auch Ahbeh sagt.
Deshalb darf man zur Einheit der Arbeit statt Watt mal Sekunde auch Wattsekunde (Ws) sagen. Eine andere Einheit für Arbeit ist Nm, Newton mal Meter, also Newtonmeter. Genauso verhält es sich mit der Ampèrestunde (Ah), der Einheit für die elektrische Ladung, also z.B. für die Kapazität von Akkus. Das Lichtjahr wäre auch noch zu nennen, eine Einheit für sehr große Entfernungen. Ein Lichtjahr ist das Produkt aus Lichtgeschwindigkeit (300.000 km/s) und einem Jahr (ca. 31.500.000s), also ungefähr 9,5 Billionen Kilometer.
Was ist dann also ein Stundenkilometer? Aus dem Vorgenannten folgt, dass es die Einheit hkm, also Stunden mal Kilometer sein muss. Das hat nichts mit Sprachwissenschaften, sondern ausschließlich mit Naturwissenschaften zu tun. Einen Ausdruck Kilometer in Bezug auf die Stunde, den unser Sprachwissenschaftler hier so nebulös konstruiert, gibt es nicht, oder sagen wir's ganz deutlich: er ist absoluter Quatsch! Egal, ob das n ein Fugen-n oder eine Pluralendung ist: dadurch wird es lediglich Quatsch mit Soße.
Der Autor blödelt dann noch etwas herum, dass ein Reihenhaus schließlich nicht das Produkt aus Reihen und Häusern sei, sondern ein Quotient, „von allen Häusern nur die, die in Reihe stehen“. Außerdem bezeichneten Sonnentage schließlich nicht das Produkt aus Sonne(n) und Tagen, „sondern Tage mit Sonnenschein“.
Gemäß dieser Logik wären also Stundenkilometer entweder „Kilometer mit Stunden“ oder „von allen Kilometern nur die, die ...“, ach was, lassen wir's einfach. Das geht auch völlig am Thema vorbei: Reihenhaus und Sonnentag sind keine physikalischen Einheiten. Herr, schmeiß Hirn. In der Tat!
Physikalische Einheiten stehen nicht zur Disposition. Sie können nicht in beliebiger Weise durch Sprach- oder andere Wissenschaftler so lange hin und her gebogen werden, bis sie ein sprachliches oder sonstiges Phänomen erklären können. Man kann aus einem Kilometer pro Stunde keinen Stundenkilometer machen. Ebensowenig kann man aus einer Kilowattstunde (KWh) ein Kilowatt pro Stunde machen, wie es manche Zeitgenossen gerne hyperkorrigieren.
Nichts für ungut, Herr Scholten, aber ich sage klipp und klar: Der Stundenkilometer ist hirnloses Dummdeutsch. Im privaten Kreis kann man das schon einmal durchgehen lassen; jeder darf schließlich so sprechen, wie es seinen Fähigkeiten und Neigungen entspricht. In öffentlich zugänglichen Medien wie Radio, Fernsehen, Print und Internet, hat der Stundenkilometer hingegen absolut gar nichts zu suchen.
Tiernahrung
Ist Ihnen schon aufgefallen, dass aus dem guten alten Tierfutter plötzlich Tiernahrung geworden ist?
Dennoch ist sie heute gewissermaßen in aller Munde. Vorbei die Zeiten, als es im Supermarkt noch Regale mit Hundefutter, Katzenfutter oder allgemein Tierfutter gab. Tiere werden heutzutage nicht mehr gefüttert, sondern ernährt! Das geht vermutlich mit dem grassierenden Gesundheitswahn einher, der allenthalben herrscht. Man muss mehr auf die Ernährung achten, schallt es aus sämtlichen Rundfunk- und Fernsehkanälen, raschelt es aus dem Blätterwald. Bei der richtigen Ernährung ist selbstverständlich auch die richtige Nahrung von äußerster Wichtigkeit. Und zwar nicht nur beim Menschen, sondern auch beim vergötterten Haustier.
Kamen früher nur Fleisch und Innereien ins Hundefutter, überwiegend Teile, die von Menschen nur ungern verzehrt werden, so findet man heute wertvolles Getreide und feinstes Gemüse, sowie Vitamine und Spurenelemente darin. Der Hersteller freut sich, weil pflanzliche Zusätze schön billig sind, das Herrchen wundert sich, woher der Hund plötzlich die Flatulenz hat. Hat ihm denn noch nie jemand gesagt, dass Hunde und Katzen nicht in der Lage sind, Pflanzenfasern zu verdauen? Die Folge: es gärt im Gedärm.
Und die Pharmaindustrie verdient auch gerne mit bei diesem Paradigmenwechsel. Jetzt brauchen nicht nur gesunde, kranke, junge, alte, sportliche und unsportliche Menschen genau abgestimmte Nahrungszusätze, sogenannte Nahrungsergänzungsmittel (was für ein teutonischer Koloss), sondern auch das liebe Vieh. In den schlechten alten Zeiten sind vermutlich tagtäglich abertausende von Haustieren elendig an Mangelernährung eingegangen. Ein dreifach Hoch auf die Vitaminpanscher!
Randerscheinung des Ganzen ist, dass die Viecher auch noch schlechte Zähne bekommen, was bei reiner Fleischernährung nicht der Fall zu sein scheint. Schon ist die Zubehörsparte mit Kauknochen zur Stelle, die angeblich die Zähne remineralisieren und auch noch gegen schlechten Mundgeruch wirken sollen. Bei Zahnfäule hilft das aber auch nicht.
Jetzt werden natürlich einige ganz Schlaue einwenden: früher auf dem Bauernhof, da haben die Hunde bekommen, was vom Tisch abfiel. Nicht nur Fleisch, sondern auch Kartoffeln und Gemüse, die Abfälle eben. Dagegen ist zunächst einmal nichts einzuwenden. Aber der Hofhund auf dem Bauernhof befindet sich normalerweise auf dem Hof und nicht im Haus. Da fällt es nicht weiter auf, wenn er hinten- und vornherum ein wenig streng müffelt. Im Hause möchte ich so eine Biogasanlage aber nicht so gerne haben.
Also: Vergesst die Tiernahrung, gebt euren Tieren wieder Futter, dann klappt's auch wieder mit dem Raumklima.
Teilen
Brauchen auch Sie stets das neueste Smart-Phone und die aktuellsten Apps, um Ihre Bilder und Filmchen noch besser und schneller mit Ihren Freunden teilen zu können?
Natürlich ist da mal wieder ein Wort aus Amerika herübergeschwappt: to share. Dieses wurde nun etwas ungeschickt mit teilen übersetzt und ist jetzt in aller Munde. Aber to share bedeutet etwas ganz anderes: Ich stelle etwas zur allgemeinen Verfügung, sodass viele andere es ebenfalls haben können, sie können daran teilhaben, und (ganz wichtig): ich habe anschließend nicht weniger als vorher. Wie könnte man das auf Deutsch mit einem Wort ausdrücken?
Gar nicht. Denn für to share (alle teilhaben lassen), to divide (unter mehreren aufteilen) und to split (unter zweien aufteilen) gibt es im Deutschen als Einzelwort nur teilen. Dennoch klingt es in meinen Ohren falsch, bemüht, hölzern und verkehrt übersetzt, es verkantet sich im Gehörgang. Ein schönes Bild** dazu: Moses steht mit hoch erhobenem Foto-Handy und Wanderstab an der Meeresküste. Unterschrift: »Moses teilt das Meer«. Trifft den Nagel auf den Kopf.
Eine ganz andere Frage ist, warum plötzlich alle alles mit allen teilen wollen. Früher hat man Freunde und Bekannte schon mal mit dem Fotoalbum gelangweilt, oder besser noch mit einem Diaabend. Heute muss man alles was einem vor die Linse kommt sofort mit der ganzen Welt teilen. Nicht etwa nur mit dem guten Freund (schau mal, was ich gestern gesehen habe), sondern mit allen Freunden und Followern in den immer zahlreicheren sozialen Netzwerken. Und die freuen sich dann ein Loch in den Bauch über so viele tolle Bilder!
Dass bei so massiver Informationsaustauscherei auch gerne mal was Wichtiges liegen bleibt, wie zum Beispiel persönliche Beziehungen, versteht sich wohl irgendwie von selbst. Wichtig ist in diesem Falle dann vermutlich nur, dass ich der ganzen sozialen Gemeinde vom Niedergang meiner Ehe, Partnerschaft oder Freundschaft en detail berichte, damit alle meine Trauer teilen können. Denn: „Geteiltes Leid ist halbes Leid“, wie schon der Volksmund zu berichten nicht müde wird.
Diesen Gedanken wollte ich nur schnell mit Ihnen teilen. Interessiert Sie nicht? Nicht mein Problem. Teilen Sie's mit Ihren Freunden ...
* wenn ich dir mein Herz gebe, dann habe ich keines und du hast zwei
**das ich leider aus Copyrightgründen hier nicht veröffentlichen darf
Reife Leistung
Sie haben Abitur? Dann wissen Sie doch sicher, warum die Hochschulreife bei uns „Abitur“ heißt und ein Neutrum ist, oder?
Wer in Österreich, der Schweiz, in Liechtenstein oder Südtirol die allgemeine Hochschulreife erwirbt, der hat „Matura“ – von lateinisch maturus, „reif“. In Frankreich erhält er das „baccalauréat“, auch kurz nur „bac“ genannt – das kommt von bacalaureus, dem ersten höheren Abschluss (lat. bacca laurea = Lorbeere). In englischsprachigen Ländern gibt es gar nichts Entsprechendes außer vielleicht einem „degree“ – von lateinisch degradus, „Stufe“.
Bei uns in Deutschland ist es das Abitur. Warum eigentlich das Abitur? Die Fraktur, die Agentur, die Blessur, die Ligatur, alle sind weiblich, nur nicht das Abitur. Weil, ja weil es sich, genau wie beim Abi, um eine Abkürzung handelt. Das ganze Wort lautet eigentlich Abiturium (und ist somit ein Neutrum). Aber auch dieses ist wiederum (glaubt man Kluge*) eine Abkürzung, nämlich für Abiturienten-Examen. Der Abiturient ist demgemäß viel älter als das Abitur. Der Abiturient ist „einer, der weggehen will“, zu lateinisch abiturire, „weggehen wollen“, von abire „weggehen“, von ire „gehen“.
Und deshalb, liebe Duden-Redaktion und liebe Sprachregulierer, sollte man das Abitur nicht A-bi-tur trennen, wie es die Neue Deutsche Rechtschreibung verlangt, sondern Ab-i-tur. Aber das sei nur ganz am Rande bemerkt.
Wer dann nach Abitur und Studium schließlich ein Diplom erhält, der bekommt wörtlich etwas Gefaltetes, von griechisch διπλοῦς (diplous), „zweifach, doppelt, gefaltet“, für den gefalteten und gesiegelten offiziellen Brief, den man einst für seine Mühen bekam. Heute gibt es ja leider nur noch Junggesellen und Meister – Verzeihung: Bachelors und Masters. Eigentlich schade.
Hat man es gar bis zum Doktor geschafft, dann ist man eigentlich ein Lehrer, von lateinisch docere, „lehren“, welches sich auch im Dozenten wiederfindet. Wohingegen der Professor aus dem lateinischen profiteri, „laut und öffentlich erklären“, entlehnt ist.
Es behaupte also bitte niemand, das Studium der Alten Sprachen sei uninteressant oder gar sinnlos!
* Kluge Etymologisches Wörterbuch, 24. Auflage, Verlag Walter de Gruyter, Berlin
Mixer-Durcheinander
In Kochshows wird in letzter Zeit fast jede Küchenmaschine als „Mixer“ bezeichnet – Versuch einer Begriffsklärung.




Ich persönlich …
… finde das eigentlich ganz gut. Haben Sie das schon einmal gehört? Was könnte das bedeuten? Was sollte es bedeuten?
Und dann: „Ich persönlich …“, „Ich für meinen Teil …“, „Wenn Sie mich fragen …“ - könnte man alles
weglassen. Wozu
dieses ständige Geschwurbel, diese Füllwörter? Na ja ich will's mal so sagen: weil sie dem Hirn eine kurze
Auszeit verschaffen um schnell weiterformulieren zu können - Sendepause
sozusagen. Weitere beliebte Modalpartikeln sind: schon, freilich, halt, eben, ja, aber, vielleicht,
einfach, doch, bloß, nur, mal, mit denen man ja doch schon einfach mal eben ganze Sätze füllen
kann, ohne ein Wort sagen zu müssen.
Gerne hebt z.B. Frau Dr. Merkel mit den Worten an: „Ich persönlich finde eigentlich …“, was absolut nichts zum Thema beiträgt. Aber das Hirn kann sich währenddessen schon mal mit anderen Dingen befassen, der Mund ist ja hinreichend beschäftigt. Angenehmer fände ich, wenn diese Füllwörterverwerter vor dem Sprechen nachdächten und dann präziser formulierte Sätze von sich gäben. Vielleicht schwiegen sie dann in dem einen oder anderen Fall sogar – kaum auszudenken.
Aber nicht nur Politiker sind von Schwurbelitis befallen. Talkshows sind wahre Horte gepflegter Wortfüllerei. „Also mir ist da ja mal folgendes passiert …“, „Dazu muss ich dann aber etwas weiter ausholen …“, „Naja, also, ich sehe das jetzt so …“. Über fünfzig Prozent Worthülsenanteil. Klingt nach Vollkorn, ist aber Wassersuppe.
Apropos: Auch in Kochshows habe ich schon gehört: „Das schmeckt ganz gut“ - gemeint war: „Das schmeckt sehr gut“, oder wie es ein gewisser steirischer Sternekoch gerne formuliert: „Mmmmmh, lecker“. Das nenne ich eine klare Aussage.
Tragische Umstände
Warum wird eigentlich fast jeder Unglücksfall von Presse, Funk und Fernsehen als tragisch tituliert?
Wenn jemand mit seinem Fahrzeug verunglückt und dabei zu Schaden oder gar ums Leben kommt, dann ist das traurig. Wenn ein Kind im Freibad ertrinkt, weil niemand seinen Todeskampf bemerkt, dann ist auch das traurig.
Um aus einem traurigen Ereignis ein tragisches Ereignis zu machen, bedarf es einer tragischen Verwicklung. Mein alter Deutschlehrer erklärte es einmal folgendermaßen: Wenn jemand von der Klippe in den Tod stürzt, dann ist das traurig. Versucht aber jemand anders diesen Sturz zu verhindern und kommt dadurch seinerseits zu Tode, dann ist das tragisch. Man spricht in solchen Fällen auch gerne von einer tragischen Verkettung von Umständen.
Befragen wir einmal Wikipedia zur „Tragödie“:
[...] Kennzeichnend für die Tragödie ist der schicksalhafte Konflikt der Hauptfigur. Ihre Situation verschlechtert sich ab dem Punkt, an dem die Katastrophe eintritt. In diesem Fall bedeutet das Wort Katastrophe nur die unausweichliche Verschlechterung für den tragischen Helden. Allerdings bedeutet diese Verschlechterung nicht zwangsläufig den Tod des Protagonisten. [...]
In unserem Beispiel bedeutet das für unseren Helden (Retter), dass sich seine Lage (Sturz) unausweichlich verschlechtert (Exitus durch Aufprall), wobei nicht unbedingt auch der Klippenspringer zu Schaden kommen muss. Mischt sich unser Held jedoch nicht ein, dann ist er kein Held, aus der Tragödie wird nichts, und der Vorgang findet ein trauriges Ende.
Also, liebe Journalisten, Berichterstatter und Sensationsreporter: Greift nicht immer gleich zur großen Tragik-Keule; auch ohne sie ist schon alles traurig genug.
Tagesschau24
Ihr blendet doch gerne solche kurzen und knappen Nachrichtenschnipsel unter Euren Sendungen ein – Ihr solltet mal den Verantwortlichen auswechseln.
Rosberg in Barcelona auf Pole vor Hamilton und Vettel.
Was will mir dieses knappe Statement sagen? Es gibt in Barcelona einen Stadtteil, der Rosberg heißt? Glaube ich nicht. Vielleicht gibt es einen Herrn Rosberg, der in Barcelona lebt und Pole ist? Nein, das ergibt auch keinen Sinn. Gut, ich gebe es zu, ich stelle mich hier ziemlich dumm. Natürlich habe ich schon einmal etwas von der Formel-1 gehört. Versuchen wir’s noch einmal: Rosberg ist also vor Hamilton und Vettel in Barcelona auf Pole. Auf Koks kenne ich, aber auf Pole ist mir neu. Sollte es sich also eventuell um die Poleposition handeln? Das ergäbe zumindest ansatzweise Sinn. Formulieren wir also neu:
Formel-1: In der Qualifikation zum Großen Preis von Spanien errang Rosberg die Poleposition vor Hamilton und Vettel.
Zu lang? Das glaube ich nicht. Auf einem handelsüblichen 16:9-Fernseher passt diese Information locker in eine Zeile. Aber weiter mit der nächsten Meldung. Diese ist schon etwas länger, passt aber auch in eine Zeile:
Syrien-Konflikt: US-Außenminister Kerry sieht Beweise für Chemiewaffeneinsatz.
Im Ansatz schon besser. Einleitend weiß man also schon einmal, dass es um den Konflikt in Syrien geht. Aber dann: Kerry sieht Beweise. Ich stelle mir das gerade bildlich vor: Er steht vor einer langen Reihe von Tischen, auf denen die Beweise ausgebreitet sind, er schreitet sie ab und sieht sie. Ich habe den Verdacht, dass ich mir hier ein falsches Bild mache. Gemeint war vermutlich:
Syrien-Konflikt: US-Außenminister Kerry hält Chemiewaffeneinsatz für erwiesen.
Das ist genauso lang, ist aber besser, weil richtiger formuliert. Bei dem sehen handelt es sich vermutlich um einen Anglizismus bzw. Amerikanismus, der sich klammheimlich in die deutsche Journalisten-Sprache eingeschlichen hat. Ebenfalls knapp daneben ging folgende Aussage:
NSU-Morde: Türkischer Außenminister Davutoglu trifft Angehörige der Opfer
... wahrscheinlich auch noch mitten ins Gesicht, oder? Vermutlich hat er sich mit ihnen getroffen, das klingt doch schon viel freundlicher (und auch friedlicher). Davon abgesehen finde ich den Ausdruck NSU-Morde grauenhaft. Mit NSU verbinde ich, als Liebhaber klassischer Automobile, die 1969 in der Audi NSU Auto Union AG aufgegangenen NSU-Motorenwerke in Neckarsulm. Dass sich eine Neonazi-Gruppe der gleichen Abkürzung bedient ist in meinen Augen purer Frevel. Aber zugegeben: Neofaschistische Mordserie ist nicht so griffig wie NSU-Morde. Ganz am Rande sei noch bemerkt, dass der türkische Außenminister Davutoğlu (Sohn des Davut/David) heißt; das „ğ“ wird nicht mitgesprochen. Man könnte also schreiben:
Neonazi-Mordserie: Türkischer Außenminister Davutoğlu trifft sich mit Angehörigen der Opfer.
Liebe hochgeachtete und seriöse Tagesschau, achte doch bitte ein wenig mehr darauf, was Du uns Zuschauern mit solchen achtlos dahingeschluderten Textchen zumutest. Zumindest sollte ein zweites Paar Augen hinzugezogen werden, um zu verhindern, dass so ein Unsinn auf Sendung geht.
Beitragsservice
Die Gebühreneinzugszentrale (abgekürzt GEZ) wurde umbenannt in »ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice« (keine Abkürzung).
Sehr geehrter Herr Soltau,
Ihre Rundfunkgebühren sind am ... fällig.
Bitte zahlen Sie den Gesamtbetrag von [um die fuffzich] Euro.
Vielen Dank.
Von Service keine Rede. Der selbe Text wie weiland bei der GEZ. Bei der erkannte man auch schon sofort am Namen, worum es geht: Gebühren (sind fällig, zahlen!) Einzug (einziehen, eintreiben, her damit!) Zentrale (alles landet auf einem großen Haufen).
Heute macht den größten Teil des Namens das Deutschlandradio aus, das vermutlich weniger als 0,01 Promille der deutschen Rundfunkteilnehmer schon einmal gehört haben. Und der zweite größere Bestandteil ist der Beitragsservice – der bekanntlich keiner ist, da mir ja schließlich keine Dienstleistung angeboten wird.
Einen Programmservice könnte ich mir als Begriff vielleicht noch vorstellen, aber damit wären dann ja die Dienstleistungen von ARD, ZDF und Deutschlandradio gemeint und nicht deren willige Schergen, die mein hart erarbeitetes Geld kassieren wollen. Beitragsservice ist ein Euphemismus, eine Blendgranate, dreistestes Dummdeutsch. Ich will sofort wieder meine gute alte, bürokratische, obrigkeitsstaatliche GEZ zurückhaben!
Aufgehangen
Gestern ist es wieder passiert: Ein falscher Mausklick und schwups – hat sich der Rechner aufgehangen!
Keine Verwechselungsgefahr besteht, wenn man sich klar macht, dass es zwei verschiedene Verben namens hängen gibt: Ein transitives, schwach gebeugtes und ein intransitives, stark gebeugtes.
Ich hänge den Mantel in den Schrank
Der Mantel hängt im Schrank
Im Präsens fällt dieser Unterschied nicht weiter auf. Im Perfekt jedoch unterscheiden sie sich deutlich voneinander:
Ich habe den Mantel in den Schrank gehängt
Der Mantel hat im Schrank gehangen
Jemanden oder etwas hängen ist transitiv und das Partizip Perfekt dazu lautet gehängt. Hängen ohne aktives Zutun ist intransitiv und das Partizip Perfekt dazu lautet gehangen. Einfacher gesagt unterscheidet man zwischen Tätigkeiten...
gehängt haben Gegensatz zu gestellt haben aufgehängt haben Wäsche, Schlüssel abgehängt haben Wohnwagen, Mitwettbewerber verhängt haben Urteil, unfertiges Gemälde
...und Zuständen
gehangen sein Gegensatz zu gestanden haben herabgehangen sein Glockenschwengel abgehangen sein Rindfleisch verhangen sein Himmel im Herbst
Sätze wie „isch han d’r Mantel in d’r Schaaf jehange“ sind im Ripuarischen völlig korrekt, im Standarddeutschen sollte man jedoch sagen: „Ich habe den Mantel in den Schrank gehängt“.
Mund-zu-Mund-Propaganda
Mund-zu-Mund-Beatmung kennt jeder, der einmal an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen hat.
Und wie sieht es denn nun mit der Mund-zu-Mund-Propaganda aus? Wie spricht sich etwas herum? A spricht in den Mund von B, B in den von C und so fort? Soweit ich das beurteilen kann, spricht man doch wohl eher in ein Ohr als in einen Mund. Woher kommt also bloß dieses schiefe Bild? Es ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit genau so ein volksetymologisches Mysterium wie der Quantensprung.
Ist das denn nötig? Bleiben wir doch, liebe Mitmenschen, insbesondere liebe Journalisten, bitte bei der Mundpropaganda, dann hängt auch das Bild wieder gerade. Es wird etwas propagiert (lat. propagare „weiter ausbreiten, erweitern“), und zwar mündlich, im Gegensatz zu schriftlicher oder bildlicher Propaganda. Ein einleuchtender und nebenbei auch viel kürzerer Begriff!
Gewöhnlich
„An so niedrige Temperaturen bin ich nicht gewöhnt“ sagten manche im vergangenen Winter. Oder „Ich bin es nicht gewohnt, dass man mich duzt.“ Was sagt man denn nun – und in welchem Falle nicht?
Man ist etwas gewohnt, das man kennt, das einem gut von der Hand geht, das man immer wieder tut – egal ob gern oder ungern. Das bezieht sich nie auf Personen.
Jemand kann gewohnt sein, täglich zur Arbeit zu gehen, nach dem Essen das Geschirr zu spülen, im Winter kalte Füße zu haben oder geduzt zu werden.
Man ist an etwas gewöhnt, wenn man es zunächst nicht kannte, es dann aber allmählich immer besser kennengelernt hat und es schließlich schätzt oder sich damit abfindet. Das kann sich auch auf Personen beziehen.
Jemand kann an den Ehepartner, an alkoholfreien Sekt, an niedrige Temperaturen im Winter, oder an die Anzüglichkeiten des Chefs gewöhnt sein.
Wichtig für die Mikrosekunden-Entscheidung: gewöhnt ist immer mit an gepaart.
Klingt einfach, ist es auch; nur die Zeit, die einem für eine Entscheidung zur Verfügung steht, ist arg begrenzt. Daher sollte man sich vorab schon einmal damit beschäftigt haben, um sich daran zu gewöhnen. Dann ist man im Ernstfall den richtigen Gebrauch gewohnt.
Liebe Hobbyköche,
schaut doch noch mal ganz genau auf die Packungsaufschrift: Das Zeug heißt Gelatine und nicht Gelantine!

Wer findet das zweite n?
Wie man es auch betrachtet, es ist einfach eine Nachlässigkeit, achtloser Umgang mit der Muttersprache. Jeder, der schon einmal sein leckeres italienisches Eis in einer Gelateria gekauft hat, der kann sich vorstellen, dass auch die Gelatine ursprünglich etwas mit gelieren, Gelee und Gelato zu tun hat. Es kommt von lateinisch (was sonst?) gelare, „stocken, gefrieren“ und hat sich dann über italienisch gelare, „stocken, gefrieren“ zu französich géler und deutsch gelieren entwickelt.
Das Partizip Perfekt von gelare ist gelato also „gefroren“. Die Endsilbe -ine kam dann im Französischen als Indikator für etwas Weibliches, auf die Küche Bezogenes dazu – vergleiche hierzu auch Margarine, Praline und Galantine. Die Bestandteile sind also Gelat- und -ine. Kein zusätzliches n.
Kann man sich doch merken, oder?
Übrigens, die Galantine (gefüllte, entbeinte ganze Tiere – Obelix lässt grüßen), über die ich gerade so galant hinweggegangen bin, kommt natürlich auch aus dem Lateinischen - genauer gesagt aus dem Vulgärlateinischen galare, „stocken, gefrieren“ und müsste demgemäß eigentlich Galatine heißen. Auch die Franzosen haben also irgendwo entlang des etymologischen Weges ein undefiniertes n aufgelesen.
Gerade habe ich einmal bei Google gesucht: 7.310.000 Einträge für Gelatine, 264.000 für Gelantine. Darunter auch dieser: Nur Dillentanten sagen Gelantine.
Mit Quantensprüngen zum Meilenstein
Neulich erst wurde im Fernsehen über einen Quantensprung in der Entwicklung biologisch abbaubarer Hosenträger berichtet. Ganz schön bedeutsam, oder?
Betrachten wir nun also einmal die Quantensprünge, die uns die Journaille so täglich um die Ohren schlägt. Darin geht es stets um riesige Fortschritte, um Meilensteine in der Wissenschaft, um globale Lösungen in der Politik, etwas Epochales, alles in den Schatten Stellendes.
Das passt doch irgendwie nicht recht zusammen. Der kaum messbare, submikroskopische Hüpfer eines Elektrons von einem Energieniveau aufs nächste dient der Beschreibung kolossaler Umwälzungen auf unserem Planeten. Wie das?
Es wird sich wohl um eine volksetymologische Umdeutung handeln: Der Quanten steht umgangssprachlich für einen sehr großen Schuh, einen Quadratlatschen eben. Man stelle sich einen Giganten mit riesigen Schlappen vor, einen Titanen mit Siebenmeilenstiefeln, die Sonne verdunkelnd, mühelos bis zum Horizont springend; die Erde bebt, nichts kann ihn aufhalten. Voilà: der Quantensprung.
Interessant ist auch, dass der Begriff Quantensprung in der Physik und angeschlossenen Wissenschaften ungern und kaum noch genutzt wird, da er „die falsche Vorstellung eines instantanen Übergangs suggeriert. Korrekt ist hingegen die Vorstellung, dass der Übergang zwar eine endliche Zeit benötigt, über den Zustand des Systems während dieser Zeit aber grundsätzlich nichts ausgesagt werden kann“ (Wikipedia). Man spricht heute allgemein von Übergängen, ein Begriff, der eher an Zebrastreifen als an überdimensionale Fußbekleidung erinnert.
Übrigens, Fa. Thomy,
Eure Plakataktion mit der etwas verschwommen aufgenommenen Senftube und der Unterschrift „Senf. Mittelscharf. Thomy.“ ist einfach ganz große Klasse!
Nun habe ich aber bei Horizont.net, einem Portal für Marketing, Werbung und Medien, gelesen, dass die Jury, die dieses Plakat Ende 2012 ausgezeichnet hat völlig inkompetent sei. Das möchte ich so nicht stehen lassen. Sicher steht niemand grübelnd vor dem Plakat, bis er von der Erkenntnis über dieses tolle Wortspiel übermannt in den nächsten Supermarkt eilt, um sich eine Tube vom Guten zu kaufen.
Aber: Ich finde, dass es sich hier um intelligent gemachte Werbung handelt, die – mich zumindest – anspricht. Und wo gibt es so etwas heute noch im tristen alltäglichen Werbe-Einerlei?

(Abbildung aus den Tiefen des www)
Außerdem meine ich, dass die Thomy-Werbung in etwa den gleichen Auftrag hat wie Reklame für die Bild-Zeitung: Jeder kennt sie, aber manchmal macht der Springer-Verlag dennoch Werbung für das Schundblatt, um in den Köpfen der Zielgruppe präsent zu bleiben. Ähnlich verhält es sich wohl mit diesem Plakat: Jeder kennt den Senf, aber ab und zu braucht es eine Erinnerung, hallo, es gibt uns noch. Und wenn die so gut gestaltet ist wie im vorliegenden Fall, dann nehme ich das mit schmunzelndem Wohlwollen zur Kenntnis.
Lieber Xavier Naidoo,
Entschuldige, bitte, dass ich es so drastisch ausdrücke, aber: Deine Texte gehen mir tierisch auf den Sack!
Und was wir alleine nicht schaffen
Das schaffen wir dann zusammen
Nur wir müssen geduldig sein
Dann dauert es nicht mehr lang
Die ersten zwei Zeilen sind von naiv floskelhafter, gleichzeitig verschwurbelt transzendenter, man möchte fast schon sagen brunzbanaler Selbstverständlichkeit beseelt. Das in etwa synonyme „Viele Hände machen der Arbeit bald ein Ende“ kennen die meisten von uns bereits seit dem Vorschulalter.
Die dritte und vierte Zeile ergeben hingegen noch nicht einmal ansatzweise Sinn. „Wenn wir geduldig sind, dann dauert es [was auch immer] nicht mehr lang“ würde im Umkehrschluss doch bedeuten: „Wenn wir ungeduldig sind, dann dauert es noch lang“, oder: „Durch warten geht alles schneller“, oder noch allgemeiner: „Nachts ist es kälter als draußen“. Wenn Du das auf Deine unnachahmlich larmoyante Art ins Mikrofon näselst, dann hältst Du das vermutlich für extrem tiefsinnig, oder?
Weiter geht’s*
... haben wieder Wind in den Segeln
Und es spricht jetzt nichts mehr dagegen
Unser Ziel zu erreichen denn viele
Zeichen zeigen wir sind überlegen
weil wir auf dem richtigen
Weg sind auch wenn uns
Gerade Probleme begegnen
Wir überstehn den Regen
Werden die Nerven bewahren und es irgendwie regeln
So wie wir's immer getan haben
Doch ohne inneren Fahrplan
Wär'n wir verloren und müssen einsehen
Dass wir uns im Kreis drehen so wie in einer Kartbahn ...

Was in diesem Lied so alles los ist ...
Unbearbeitetes Paste-and-Copy-Zitat aus dem (mittlerweile leider eingestellten) Blog von twentysixseven **** schreibt am 19.11.2006 um 16:41 Uhr:
„Dieses Lied ist einfach der hammer ! Und der Sänger sowieso ! Man kann keinen Sänger mit ihm vergleichen ! Seine Texte sind einfach so was von emotional !Immer wenn ich das neue Lied " Was wir allein nicht schaffen, dass schaffen wir dann zusammen " höre werd ich voll Nachdenklich und muss zum Teil auch weinen !“
*Alle Zitate aus Xavier Naidoo: „Was wir alleine nicht schaffen“.
Je länger je lieber
„Je schneller du gehst, je eher bist du wieder hier“, empfiehlt die Mutter dem Sohn, der noch schnell sechs Eier kaufen soll, dazu aber wenig Lust hat.
Oder heißt es umso? „Je schneller du gehst, umso eher bist du wieder hier.“ Nein, das klingt auch irgendwie verkehrt. Unser aller Duden, das Fähnlein, wie immer, hart an Volkes Stimme Wind, erklärt es für zulässig.
Im Deutschen gibt es jedoch das Paar je/desto. Mit dem funktioniert es einwandfrei, es klingt vertraut und es entbehrt auch nicht einer gewissen Eleganz: „Je schneller du gehst, desto eher bist du wieder hier.“ So sollte es sein.
Mit umso kann man übrigens noch andere Paarkonstrukte wie umso/als oder umso/weil bauen. Das klingt dann aber reichlich gestelzt. Duden-Online bietet uns folgendes Beispiel an: „diese Klarstellung ist umso dringlicher, als/weil es bisher nur Gerüchte gab“. Das kann man so sagen, klingt aber eher nach Politsprech.
Was ist denn nun aber mit Jelängerjelieber? Das ist die Trivialbezeichnung für das Gartengeißblatt (Lonicera caprifolium) und stammt wohl noch aus einer Periode, in der Konrad Duden noch nicht die Alleinherrschaft über die deutsche Sprache ausübte. Und wie sagt schon der Volksmund? Je öller, je döller.
Jetzt ...
Herr Meier vom Fernsehen braucht eine Werbepause, aber er verabschiedet sich nicht ohne eine Vorschau auf kommende Sensationen, die „jetzt – live in Akte“ bevorstehen.
Schon oft ist es in der Geschichte der Deutschen Sprache geschehen, dass sich der Sinn eines Wortes verändert, ja manchmal gar in sein Gegenteil verkehrt hat. Zum Beispiel das Wort toll. Es bezeichnete einst einen abnormalen Geisteszustand – die Tollkirsche kündet heute noch davon. Auch geil hat sich in seiner neuen Bedeutung durchgesetzt – früher bedeutete es sexuell erregt, lüstern bei Tieren, oder üppig, aber kraftlos wachsend bei Pflanzen. Nun also wandelt sich auch das Wort jetzt, und zwar zu später, im Anschluss an die Werbung. Jetzt, damit die Zuschauer dran bleiben. Jetzt nicht wegschalten, denn jetzt geht's schon weiter ...
Mal im Ernst: hält man den Zuschauer für so beschränkt, dass er durch das mantrahaft wiederholte „jetzt“ die Finger von der Fernbedienung lässt? Hier handelt es sich sicher um eine Fehleinschätzung: der gemeine TV-Konsument – und zu dieser Spezies zähle ich mich auch – schaltet einfach um, weil ja jetzt doch nichts passiert, außer Werbung. Ein ehrliches „gleich“ hätte ihn vielleicht bei der Stange gehalten.
Die beste Alternative
Für die Überwindung der Krise gibt es diverse Alternativen. Welche ist die beste? Kennen Sie welche? Nein? Ich auch nicht.
... zwischen zwei Möglichkeiten die Wahl lassend, eine zweite Möglichkeit bildend [...] aus l. alter ‚der andere’...
Warum also wird ständig von mehreren Alternativen gesprochen? Richtig! Der Ami war's. Dem geht Latein nämlich am Allerwertesten vorbei, und der macht sich seine Welt widdewidde wie sie ihm gefällt. Deshalb gibt es dort die Alternative eben auch im Plural. Und der Deutsche plappert's dem Ami halt gerne nach.
Wenn es denn schon ein Fremdwort sein muss, warum nicht Optionen? Davon kann es unendlich viele geben. Oder vielleicht Möglichkeiten? Nein, keine alternativen Möglichkeiten – einfach nur Möglichkeiten. Die deutsche Sprache ist sehr präzise.
Aber auch die Alternative hat Optionen: Gegenentwurf, Gegenmodell, Gegenvorschlag, Wahlmöglichkeit. Von Alternativlosigkeit kann, zumindest hier, nicht gesprochen werden.
Was ist dass den?
Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Kaum jemand bekommt das mit dem Dass noch richtig hin.
Drei Fehlerbilder lassen sich grob unterscheiden:
- Die einen benutzen grundsätzlich das, ohne Ansehen der
Funktion oder Stellung. Dafür habe ich in gewisser Weise sogar
Verständnis. Es wäre bei der letzten Rechtschreibreform ein Leichtes
gewesen,
hier alle Zweifel auszuräumen und nur noch das zuzulassen.
Aber das wäre dann wohl zu einfach gewesen.
- Eine zweite Gruppe erinnert sich anscheinend noch dunkel des
Unterrichts in der Grundschule. Haben wir dort nicht gelernt, dass man
dass
immer nach einem Komma schreibt? Das stimmt zwar manchmal, aber nicht immer,
dassdas kann man hier schön sehen.
- Die dritte Gruppe interessiert sich überhaupt nicht für Orthografie und schreibt wie sie lustig ist. Mal groß, mal klein, mal mit Einfach-, mal mit Doppelkonsonant, ganz wie’s beliebt, einer inneren Stimme folgend – und das hört beim Dass noch lange nicht auf (siehe Überschrift).
Dabei ist doch alles so einfach:
- Als Artikel benutzt man
das. Das Haus, das
Auto, das Kind.
- Ist es ein Relativpronomen
und kann es durch welches ersetzt werden, schreibt man
das.
- Ist es ein Demonstrativpronomen
und kann es durch dieses/jenes ersetzt werden,
schreibt man das.
- In allen anderen Fällen steht die Konjunktion dass.
„er sagt, dass das das Buch sei, das er gelesen hat“ = „er sagt, dass dieses/jenes das Buch sei, welches er gelesen hat“
Nicht unerwähnt lassen möchte ich noch die Gruppe derer, welche die oben genannte Unterscheidung zwar souverän beherrschen, „dass“ aber immer noch „daß“ schreiben. Fest steht, dass die Zerlegung des „scharfen S“ am Wort- bzw. Silbenende – in Eszett (ß) nach langen und Doppel-S (ss) nach kurzen Vokalen – zu den wenigen wirklich einleuchtenden Neuerungen der viel geschmähten Rechtschreibreform von 1996 gehört. Ein Häuflein ewig Gestriger will das wohl immer noch nicht einsehen, bildet jedoch eine schnell schwindende Minderheit. Das Problem wird sich also hoffentlich in den kommenden dreißig bis vierzig Jahren biologisch erledigt haben.
Natürlich darf in Deutschland jeder so schreiben, wie es ihm beliebt – dagegen gibt es kein Gesetz. Aber ich meine, dass jeder, der so irgendwie und ungefähr schreibt, sich und seiner Schulbildung ein Armutszeugnis ausstellt (Legastheniker seien hier ausdrücklich ausgenommen). Regeln gehören nun einmal zum Leben, und so schwierig ist das mit dem Dass ja nun auch wieder nicht – jedenfalls nicht halb so schwer wie die Abseitsregeln im Fußball.
Hallo Fans!
Fast jeden Abend vor der Tagesschau kurz vor acht Uhr schaut mich ein lustiger Schimpanse mit einer lustigen Brille an und ruft mit lustiger Stimme: „Hallo Fans!“
Erstmal: Ein Schimpanse? Findet heute noch irgendjemand Menschenaffen lustig? In Vor-Fernseh-Zeiten, als Menschen noch auf Jahrmärkte gingen, oder in den Zirkus, um allerlei drolliges und exotisches Getier zu bestaunen, da konnte man noch mit Fug und Recht einen Schimpansen für lustig halten.
Zum Zweiten: Kann man so etwas noch schlechter filmen? Der Affe sitzt da, wahrscheinlich angeschnallt, damit er nicht weglaufen kann, die Brille sitzt schief im Gesicht (woran soll sie auch halten), am behaarten Leib trägt er Hemd und Krawatte (die übrigens nachweislich nicht von Trigema® sind). Und auf diese Weise artgerecht gewandet schaut uns dieses bedauernswerte Tier einigermaßen gelangweilt an und kaut dabei Nüsse, um Sprechbewegungen zu simulieren. Dass man das auch viel besser hinbekommen kann zeigen ein Schweinchen namens Babe oder ähnlich lustige Spielfilme, oder – um bei der Werbung zu bleiben – die unvergessenen Brüllaffen von Toyoooota. Dort werden die Sprechbewegungen mittels Computertechnik so hingebogen, dass sie auch zum Gesprochenen passen.
Und dann: Der Text, die Botschaft, die Aussage. Mit hallo Fans begrüßte, wenn ich mich recht entsinne, Ilja Licht-Aus-Spot-An Richter in den Siebzigern seine Fangemeinde. Was aber veranlasst den Werbetexter von heute anzunehmen, dass so ein erbarmungswürdiger Primat Fans haben könnte? Wieso erklärt mir ein Schimpanse (mit der Synchronstimme von Alf), dass er ausschließlich Klamotten von Trigema® kaufe? Davon abgesehen, dass Affen nicht sprechen können, brauchen sie auch gar keine Kleidung!
Schließlich: Der Chef von dem Laden, der König von Burladingen, Wolfgang Grupp. Der stelzt wie ein Gockel mit stolzgeschwellter Brust durch die Reihen seiner Produktionsstätte, eine Hand in der Hosentasche, die andere weist mit weiter Geste auf sein Reich von Nähmaschinen und (vermutlich krass unterbezahlten) Näherinnen, wobei er über sichere Arbeitsplätze in Deutschland schwadroniert.
Wer denkt sich eigentlich so einen Scheiß aus? Glauben die tatsächlich, dass man mit solch einfältigen Methoden auch nur einen Fetzen mehr verkaufen kann? Lohnt es sich wirklich, für so einen Bockmist Premium-Werbezeit bei der ARD zu kaufen? Ich bitte um Verzeihung, aber das löst bei mir Brechreiz aus, da greife ich reflexartig zur Fernbedienung.
PS: Dies stellt lediglich meine persönliche Meinung zu diesem Fernsehspot dar, nicht jedoch zur Fa.Trigema®
oder deren Produkten, zu denen ich keine Meinung habe.
PPS: Ich glaube, ich wurde erhört: Der Affe ist Ende 2015 endlich in Pension gegangen. Danke!
PPPS: Wir schreiben das Jahr 2017. Der Affe ist wieder da! Diesmal aber professionell (wenn auch
nicht originell) in Szene gesetzt. Erbarmen! Gebt dem Tier
endlich sein Gnadenbrot.
PPPPS: Wie ich erfahren habe, handelt es sich nunmehr um eine 3D-Animation.
Dagegen habe ich nichts einzuwenden. Die Werbung ist dadurch
jedoch nicht einen Deut besser geworden.
Platzangst
Ich krieg hier drin Platzangst, hört man bisweilen im Aufzug oder im überfüllten Bus. Will heißen: Ich habe Angst, weil hier so wenig Platz ist – aber ich sag's mal wissenschaftlich.
Die Angst vor engen Räumen, die Klaustrophobie, ist jedoch viel weiter verbreitet unter uns Normalverbrauchern. Niemand befindet sich gern mit vielen fremden Personen in einem engen Raum, und je älter man wird, desto schlimmer wird diese Abneigung – ich kann ein Lied davon singen. Und da es eine Angst ist, kann man sie nicht greifen, man kann ihr nicht begegnen.
Furcht wäre einfach. Die hat man vor etwas Konkretem; vor Hundebissen, Insektenstichen, Blutvergiftung. Dem kann man begegnen, indem man Gegenmaßnahmen ergreift, sich von Hunden fern hält, feste, enganliegende Kleidung trägt oder sich gegen Tetanus impfen lässt. Aber Angst – mit der muss man zum Psychologen*. Davor hätte ich Angst – besonders bei vollen Wartezimmern, da bekomme ich immer Platzangst …
* ist Psychologie überhaupt eine Wissenschaft?
Nutzt nix
Gibt es einen Unterschied zwischen nutzen und nützen? Wenn ja, welchen? Und ist das wichtig?
Verantwortlich für diese Verunsicherung ist nicht das Sprachzentrum - das arbeitet völlig autark - sondern die nachgeschaltete Qualitätskontrolle, die alles, was unser Sprachzentrum verlässt in Echtzeit auf Irrtümer untersucht, die im Sprachzentrum eventuell schon fest verdrahtet sind. Trifft die QC auf einen Fehler, dann wird er bei minderschweren Vergehen ignoriert, bei wichtigeren Dingen wird schon mal ein Pausenzeichen (Ähh) gesendet und alles zurück geschickt.
Nutzen also – und es folgt noch ein schnell verhallendes Nachschwingen, ein schwer fassbarer Gedanke, irgendwann muss ich mich doch einmal damit befassen, und dann ist es auch schon wieder vorbei – das Gespräch geht weiter. Vielleicht haben Sie sogar schon einmal benützen benutzt? Kann man – sollte man aber nicht.
Grammatikalisch handelt es sich in beiden Fällen um transitive, schwach gebeugte Verben; das eine wird vom Dativ regiert (wem nützen), das andere vom Akkusativ (wen nutzen). Sie sind also sicher nicht identisch. Wenn man sagt A nutzt B, dann bezieht A den Nutzen von B. Sagt man jedoch A nützt B, dann bezieht B den Nutzen von A. Es sind also eher Gegensätze als Synonyme. Jetzt wird auch klar, warum man nicht benützen sagen sollte (der Schweizer tut's trotzdem) – es ergibt einfach keinen Sinn. Ähnlich unsinnig ist abnützen oder ausnützen. Auch der Spruch aus der Überschrift ist natürlich verkehrt. Es muss heißen es nützt nicht – aber wer sagt das schon?
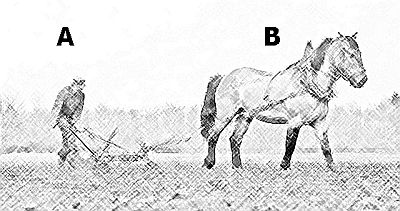
Es nutzt nix – jeder redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Dass dieses Problem aber auch schon recht alt ist, zeigt der bereits lange bekannte Nichtsnutz (der natürlich nicht nützt). Der Unnutz hingegen hat durchaus seine Daseinsberechtigung, da er eigentlich ein Unnutzen ist. Genau wie das Adjektiv unnütz, welches eine Verkürzung von unnützlich ist. Die eher exotische Nutzniessung gibt es nur in der Schweiz (mit doppeltem s, weil das ß von den Eidgenossen abgeschafft wurde). Das Nutztier heißt so, weil wir es nutzen – genau so gut könnte es aber auch Nütztier heißen, weil es uns nützt. Der Nutzen ist es wiederum, der dem Nutzer nützt, welcher ihn nutzt.
Verwirrend? Nein – wenn man Zeit hat (z.B. beim Schreiben). Ja – wenn die Mikrosekunden ticken: Los jetzt! Entscheide dich! Was soll’s denn nun sein – und schon hast du mal wieder das falsche Wort … benützt …
- Anfang -
Ausgewiesene wie auch nicht ausgewiesene Warenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern. Alle Abbildungen aus den Tiefen des www, oder aus Eigenproduktion.
